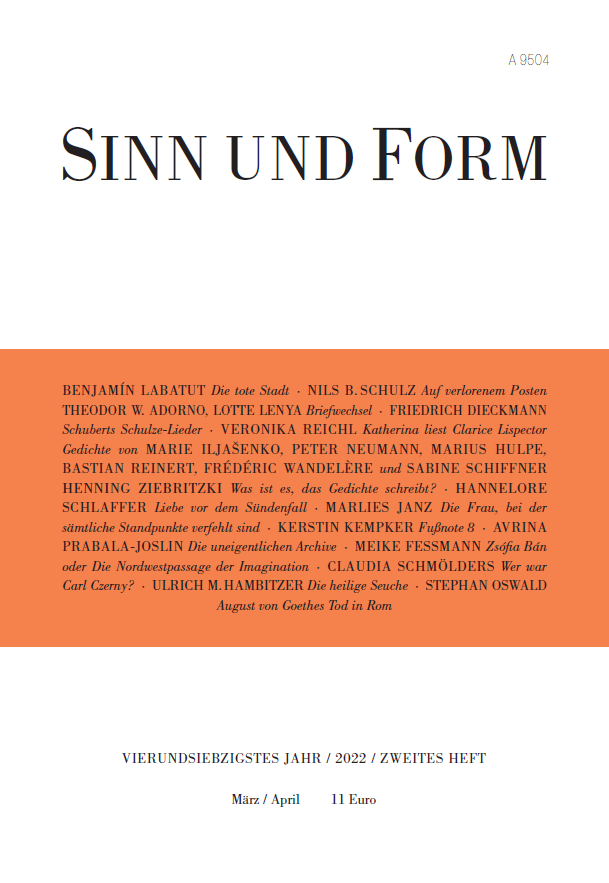
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-64-5
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 2/2022
Reichl, Veronika
Die Hummeln summen lauter. Katherina liest Clarice Lispector
Katherina hatte schon als Kind die Schönheit schwergenommen: Sie hielt es nicht aus, wenn etwas Schönes verging, ohne ganz gesehen worden zu sein. Während ihre Eltern bei Wanderungen immerzu weiterwollten, weil sie an den Kaiserschmarrn in der Gastwirtschaft oder den Kuchen zu Hause dachten, konnte Katherina einem berückenden Sonnenuntergang kaum den Rücken zukehren. Es wäre furchtbar, wenn die Schönheit umsonst dagewesen wäre. Nur wenn Katherina sah, daß andere Menschen den Sonnenuntergang bewunderten, mochte sie weitergehen. So ging es ihr mit allem, was sie liebte. Katherina trauerte die letzten drei Wochen der Sommerferien darum, daß sie zu Ende gingen. Der kommende Tod ihre Oma machte sie schaudern, das kommende Sterben ihrer Eltern war zu schrecklich, um gedacht zu werden. Und doch wußte sie jeden Tag darum. Das gab ihr etwas Altmodisches, aus der Zeit Gefallenes. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler verstanden nicht, daß alles eines Tages wirklich und für immer verschwindet. Sie lebten, als beträfe der Tod sie nicht. Katherina dagegen sah, wie durch und durch angemessen es war, unendlich traurig zu sein.
Als Katherina zehn Jahre später in Frankfurt studierte, bemühte sie sich, das Leben leichter zu nehmen. Sie fand neue Freundinnen und Freunde, die wie sie für Kultur und Philosophie brannten und sich um die Umwelt, den Rechtsruck der Gesellschaft und alle Arten von Ungerechtigkeiten sorgten. Über alle diese Dinge konnte sie nun endlich nächtelang mit anderen sprechen. Doch sie war mit ihrer Trauer über das Vergehen der Schönheit immer noch ziemlich allein. Weiterhin spürte sie eine Pflicht, möglichst viel Schönheit wahrzunehmen und ihr Verschwinden zu betrauern. Niemand außer ihr schien diese Aufgabe zu übernehmen.
Während sie an ihrer Dissertation schreibt, kommt Katherina durch ihre Lieblingsphilosophin auf Clarice Lispector. Die wichtigen Dinge zeigen einem ja immer die anderen. Sie und die Philosophin lernen sich bei einer Konferenz kennen und unterhalten sich länger beim Conference-Dinner, und die Philosophin sagt: Sie müssen Die Passion nach G. H. lesen. Gerade Sie, unbedingt! Sie erzählt voller Begeisterung, daß der Text von der Begegnung einer Frau mit einer Schabe in einem kleinen Raum handelt und gleichzeitig vom Leben und der Immanenz an sich. Die Philosophin ist klug und empfindsam und hat einen feinen Humor. Sie ist persönlich fast noch beeindruckender als in ihren Texten. Katherina möchte gern so ähnlich sein, wenn sie einmal sechzig ist. Es wird Katherina ob der persönlichen Empfehlung warm ums Herz. Doch das Buch ist vergriffen und die Fernleihe der Stabi weist eine ellenlange Warteliste auf. Vier Monate später findet Katherina das Buch in der Grabbelkiste eines Antiquariats. Es liegt da wie für sie hingelegt: ein dünner, vergilbter, grasgrüner Suhrkamp-Band für zwei Euro. Katherina freut sich ungeheuer. Sie trägt das Buch nach Hause, legt sich ins Bett und beginnt zu lesen. Der Text hat sofort etwas Besonderes. Katherina hält den Atem beim Lesen an, so schön ist die Sprache. Da steht zum Beispiel:
»Nein. Jedes plötzliche Verstehen ist schließlich die Enthüllung eines durchdringenden Nichtverstehens. Jeder Moment des Findens ist ein Sich-Selbst-Verlieren. Vielleicht widerfuhr mir ein Verstehen so vollständig wie eine Unwissenheit, und daraus gehe ich so unberührt und unschuldig hervor wie vorher. Kein Verständnis meinerseits wird jemals die Höhe dieses Verstehens erreichen, denn zu leben ist die einzige Höhe, die ich erreichen kann – meine einzige Ebene ist, zu leben. Nur daß ich jetzt – jetzt von einem Geheimnis weiß. Das ich schon wieder beginne zu vergessen, ach ich spüre, ich vergesse …«
Doch obwohl der Text Katherina fasziniert und sie Satz um Satz anstreicht, kann sie nach dreißig Seiten kaum sagen, was eigentlich gesagt wird. Das ärgert sie, denn sie möchte das Buch so tief in sich aufnehmen, wie es nur geht. Sie nimmt den Text deutlich wahr: Er ist erstaunlich hell. Er leuchtet geradezu. Katherina hatte Angst gehabt, daß die Schabe ihn ekelhaft machen würde. Sie hatte Erde, Schweiß und Kotze erwartet. Aber das kommt nur hier und da vor. Vor allem gibt es gekalkte Wände und Plasmen, die Wüste und die helle Sonne. Lispector spricht vom Leben an sich. Und doch mutet sie Katherina dieses Leben nur in kleinen Dosen zu. Sie gibt Katherina nur ein wenig Plasma, ein wenig weißliche Masse, ein paar Augenblicke blanken Lebens zu lesen. Katherina fühlt sich auf eine merkwürdige Weise geschont und weiß nicht, ob sie das gut finden soll.
Beim Weiterlesen wird Katherina nach und nach klar, daß Clarice Lispector versucht, von etwas kaum Sagbarem zu sprechen. Mit immer neuen Sätzen nähert sie sich etwas an. Darum widerspricht und verbessert sich die Erzählerin wieder und wieder: Weil der Text eine Suche ist, die zu keinem endgültigen Ergebnis kommt. Katherina muß das bewundern: diesen Eigensinn, ein ganzes Buch lang zu versuchen, etwas auszudrücken, was sich dem Ausdruck entzieht. Diese selbstbewußte Hartnäckigkeit einer Frau.
Die Erzählerin sagt irgendwo: »Ach, ich weiß nicht, wie ich es Dir sagen soll, denn ich neige nur dann zur Beredsamkeit, wenn ich irre, der Irrtum verleitet mich dazu zu diskutieren und nachzudenken. Doch wie soll ich mit Dir reden, wenn Schweigen herrscht, solange ich nicht irre?«
Katherina hat das Gefühl, daß das für das ganze Buch stimmt. Die Erzählerin versucht etwas zu formulieren, das so zentral und so schwer zu denken ist, daß die bestmögliche Annäherung ihr hundertfacher, übermütiger Versuch ist, einen Zipfel davon zu formulieren. Die Erzählerin ist bereit, sich tausendmal zu täuschen, tausendmal das Falsche zu sagen. Sie übertreibt immerzu. Nichts von dem, was sie sagt, stimmt ganz. Und trotzdem: Während der Text immer wieder neu ansetzt und immer wieder beredt wird in etwas, das Katherina als übertrieben und nicht ganz richtig wahrnimmt, sagt Lispector etwas, das zwar so nicht richtig sein mag, aber ein wenig anders gedreht vielleicht doch ganz ungeheuer richtig ist. Katherina vertraut Lispector. Denn der Text beschreibt Wahrnehmungen, Katherina kann es genau hören. Lispector fängt jeden ihrer Beschreibungsversuche mit einem Perzept an. Katherina haßt es, wenn Texte erfunden sind. Sie interessiert sich nicht für das, was die Leute sich so ausdenken. Schrecklich viele Romane tun das, manche gewinnen dabei sogar Preise für ihre Sprache, und Katherina schüttelt es. Weil man doch hört, wenn die Sprache lügt, wenn die Autorinnen und Autoren Satz für Satz die schnelle Pointe suchen und dabei Satz für Satz die Wahrheit opfern. Vermutlich ist ihnen das nicht einmal klar. Lispectors Text aber hat seinen Ursprung in Wahrnehmungen. Auch Lispector erfindet öfter mal etwas, auch sie ist immer wieder zu begeistert von ihren Ideen und läßt sich von ihnen fortreißen. Aber dann setzt sie wieder neu an.
Nach ein paar Tagen findet Katherina den perfekten Vergleich, um das Gefühl, Lispector zu lesen, zu beschreiben. Es fühlt sich an wie mit dem Rauchen aufzuhören. Wie damals fühlt Katherina sich noch ein Stück weiter vom Rest der Menschen entfernt. Wie damals fühlt sie eine leuchtend hellgraue Nüchternheit, die unbequem ist. Wie damals kann sie nicht sagen, welcher Rausch sich da eigentlich gelichtet hat. Und doch möchte Katherina diese hellgraue Nüchternheit – damals wie heute – nicht zurücktauschen gegen den angenehmen Nebel zuvor.
Nach 110 von insgesamt 180 Seiten beginnt Katherina darauf zu warten, daß es nun wirklich richtig losgeht. Denn sie hat zwar Seite für Seite das Gefühl, daß alles wichtig ist, aber sie kann den Inhalt weiterhin nicht recht festmachen. Sie findet sich selbst undankbar. Die bisherigen Seiten waren toll, sie sollte erfüllt sein. Und wenn man 110 Seiten in einem Buch gelesen hat, das immer neu ansetzt, ohne wirkliche Aussagen zu machen, warum sollte da noch etwas anderes kommen? Doch es stellt sich heraus, daß Katherina zu Recht gewartet hat: Die letzten 40 Seiten haben noch einmal einen besonderen Schub. Ein paar wichtige Motive bekommen einen ganz neuen Dreh und Gott bekommt vier Seiten, die Katherina den Atem nehmen. Katherina kommt aus einer katholischen Familie, Gott ist ihr wohlbekannt. Sie kennt ihn als einen gewalttätigen und fordernden Gott. Sie glaubt längst nicht mehr katholisch, doch sie weiß, daß die Position Gottes nicht leer ist. Was auch immer diesen Platz besetzt, es hat Macht. Und da sie keine stabile Alternative hat, drängt ihr alter christlicher Gott mit seinem Purpur und Gold und seinen tief in Katherina eingebrannten Formeln ständig in diese Position. In ihrer Kindheit auf dem Land war Katherina in ihrem Kampf gegen Gott allein, an der Uni kommt Gott nicht einmal vor. Die meisten Menschen um sie herum sprechen, als wäre das Leben im Prinzip freundliche Vernunft und gegen den Rest hülfe Homöopathie. Und selbst denen, die den Ernst der Lage spüren, ist Katherinas Interesse an Gott und ihr Kampf mit ihrem katholischen Erbe fremd. Lispector aber kennt Gott. Sie weiß um den Tod und um die Gnade. Katherina hat das Gefühl, Lispector biete ihr einen Tausch an: Katherina könnte ihren alten Gott gegen einen neuen, neutralen, farblosen Gott eintauschen. Nur so kann es gehen: Im Tausch von etwas angsterregend Universellem gegen etwas anderes angsterregend Universelles. Auf der Grundlage von Wahrnehmungen. Alle, die das Leben ohne Angst und Schmerz wollen, verkennen die Bedingungen ihrer eigenen Existenz. Katherina würde sehr gern Gott gegen Gott tauschen und liest die vier Seite viele Male.
* * *
Den Sommer verbringt Katherina mit einer Freundin schreibend in einem Gartenhaus. Sie stellen die Rechner auf alte, klapprige, grünlackierte Holztische und sitzen unter einem Kirschbaum, rundherum die Sträucher eines halbverwilderten Gartens. Sie gehen jeden Abend im See schwimmen. Wenn es sehr heiß ist, liegen sie in den Hängematten und dösen. Um sie summen Bienen und Hummeln. Im Gras zirpen die Grillen. Es ist herrlich.
Katherina hat es nicht geschafft, Gott gegen Gott zu tauschen. Als Anleitung für diesen Schritt taugte Lispectors Buch dann doch nicht. Doch etwas ist anders geworden, seit sie Lispector gelesen hat. Sie ist irgendwie fröhlicher. Die Hummeln summen seitdem lauter. Die Blätter der Eschen und Buchen rauschen unentwegt. Alles Lebendige ist ungeheuer stark. Überall sirren Insekten. Bisher erschien Katherina alles Leben zart und zerbrechlich. Und das ist es ja auch. Doch die Blätter der Bäume werden immer rauschen und immer werden Viecher herumkrabbeln. Auch dann, wenn Katherina längst nicht mehr da sein wird. Selbst wenn alle Bienen an Pestiziden sterben, selbst wenn die Erde zerspringt, werden auf einem anderen Planeten Schaben krabbeln. Bei Lispector ist jedes Leben mit gleich viel Bedeutung angefüllt. Jedes einzelne ist unendlich wichtig und zugleich völlig egal. Im Gartenhaus fühlt es sich tatsächlich so an. Wenn das so ist, muß Katherina keine Zeugin der Schönheit mehr sein. Weil immerzu neues Leben nachkommt, immer noch mehr Leben, das von innen vor Bedeutung leuchtet. Bisher war es Katherinas Aufgabe gewesen, die vergängliche Schönheit in sich aufzubewahren und um alles Verlorene zu trauern. Lispector hat ihr diese Aufgaben genommen. Sie hat Katherina unwichtiger gemacht. Sie hat sie den Schaben ähnlicher gemacht. Katherina und die Schaben sind heilig und zugleich unwichtig, und sie alle fliegen schnell durchs Leben und dann sind sie weg. Katherina wird weiter studieren. Sie wird weiter politisch streiten, sie wird Bücher schreiben und hoffentlich irgendwann selbst Professorin sein. Sie wird jedesmal untröstlich sein, wenn jemand stirbt, den sie liebt. Doch das alles ist nicht wirklich wichtig. Nur das Leben an sich ist wichtig. Katherina, die keine Kinder möchte, hat keine weitere Aufgabe, als lebendig zu sein, solange sie es ist. Katherinas Arbeit, ihre Karriere und sogar die Politik sind nur eine Zugabe, eine Spielerei. Das tut weh. Seit ihrer Kindheit war Katherina eine ernste Person, die alles besser verstand als die anderen und deshalb die große Aufgabe übernahm, um die vergehende Schönheit zu weinen. Sie hatte schon vor Jahren verstanden, daß das eine tendenziell narzißtische Idee ist. Weil es beinhaltete, daß sie eine größere Empfänglichkeit für die Schönheit und ein klareres Wissen um die Vergänglichkeit hatte als die anderen. Sie hatte sich eine Sonderrolle gegeben und sich selbst besonders wichtig genommen. Das war nicht sympathisch, und so hatte sie das Ganze mit zwei Therapeutinnen ausführlich besprochen, um es loszuwerden. Doch es war ihr nicht gelungen. Das Gefühl, daß dies nun einmal ihre Aufgabe war, war zu stark gewesen. Es hatte aus einer großen Tiefe an ihr gezogen und sie mit dieser Tiefe verbunden. Sie hatte das Gefühl geliebt. Das konnte sie nicht einfach loslassen. Vielleicht hatte ihr die Aufgabe des Trauerns auch geholfen, sich selbst als künftige Philosophin ernst zu nehmen und zu glauben, einen besonderen philosophischen Beitrag leisten zu können. Jetzt im Garten zieht die Aufgabe nicht mehr an ihr. Die Tiefe ist nicht mehr da, es gibt sie einfach nicht mehr. Dafür summen die Bienen und die Bäume rauschen und Katherina ist eine irgendwie fröhliche, aber auch verwirrte Schabe. Eine Schabe ohne Aufgabe. Daran muß sie sich erst mal gewöhnen.
SINN UND FORM 2/2022, S. 215-219
