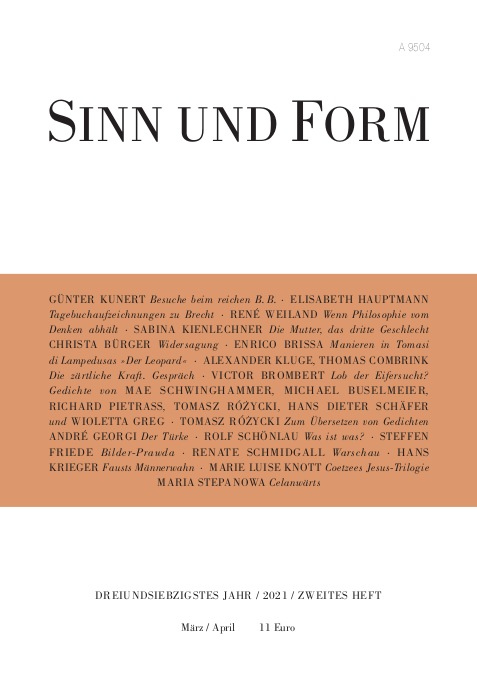
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-58-4
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 2/2021
Różycki, Tomasz
Sternenvehikel. Zum Übersetzen von Gedichten
1. Als ich, zusammen mit anderen mehr oder weniger gelungenen Definitionen von Poesie, vor Jahren Robert Frosts Aussage »I could define poetry this way: it is that which is lost out of both prose and verse in translation« in polnischer Übersetzung zum ersten Mal las, fand ich sofort, dies sei einer jener wunderbaren und zugleich scheußlichen Sätze, in denen kein Wort ersetzt oder gar umgestellt werden kann. Ein Satz wie eine mathematische Gleichung mit einer Unbekannten. Und zugleich eine dieser Definitionen, die, statt etwas zu erklären, weitere Fragen provozieren und uns nicht sicherer machen, sondern leicht benommen und verloren zurücklassen. Wenn sie überhaupt etwas sagt, dann vor allem, was Poesie nicht ist – was sie sein könnte, bleibt offen. Eine Definition, die nichts definiert, die zu keiner Grenze und zu keinem Ende führt, wie sie es dem lateinischen Ursprung des Wortes nach sollte. Eine negative Definition. Es gibt keine Grenze. Es gibt kein Ende. Solche Definitionen mag ich am liebsten. Vielleicht liegt es am Alter, vielleicht an den Dingen, mit denen ich mich beschäftige.
2. Da schon das Wort Grenze fiel: Bei allem, wovon hier die Rede sein wird – Dichtung, Schreiben, Übersetzen –, geht es um vorhandene oder fehlende Grenzen. Es geht darum, sie zu überschreiten, sowohl konkrete, wie Mauern, Stacheldrahtverhaue oder Minenfelder, als auch abstrakte, wie Verbote oder strikte Formen. Das sage ich nicht allein deswegen, weil ich über Fragen des Übersetzens spreche und aufgrund meiner Tätigkeit besonders neugierig bin, was auf der anderen Seite ist, unter anderem auf der Seite der Übersetzer. Ich sage es auch nicht deswegen, weil das Übersetzen heute eine Wertschätzung erfährt wie wohl nie zuvor und weil immer mehr und immer besser übersetzt wird. Dadurch hat die Menschheit die Chance, sich besser kennenzulernen, sich neuer schmerzlicher Details ihrer Existenz bewußt zu werden. Manche behaupten, die Übersetzer retteten die Welt, zu deren größten Problemen es gehöre, daß die Menschen einander nicht verstehen. Sowohl die Globalisierung als auch der große babylonische Turm der westlichen Zivilisation sind nicht zuletzt das Verdienst von Übersetzern. Der menschliche Drang zu Systematisierung und Abgrenzung hat die Translationswissenschaft hervorgebracht, die inzwischen an fast allen Universitäten praktiziert und gelehrt wird. Es wird immer mehr übersetzt und immer weniger gelesen, und vielleicht wachsen deshalb Bitternis und Verzweiflung in der Welt analog zur Zahl ihrer Bewohner, analog zur Zunahme der Möglichkeiten, sich zu äußern, und zur Meinungsfreiheit, während sich in fast allen Sprachen das fortschreitende Bewußtsein vom Ende der Menschheit zu Wort meldet. Wenden wir uns also wieder dem Ende zu, dem Begriff der Grenze, dem Transitverkehr und der Immigration der Wörter.
3. Zunächst geht der Dichter über seine Grenzen hinaus. Er tut das, indem er Wörter schreibt, Buchstaben zu Wörtern zusammensetzt. Dabei offenbart sich seine psychische – oder vielleicht sollte man sagen: geistige – Substanz. Dann geht der Leser aus sich heraus, indem er liest. Seine psychische – oder geistige – Substanz findet ihren Platz auf den für ihn anfangs ja fremden Seiten der Dichtung. Und manchmal geschieht ein Wunder: Der Leser betrachtet die Wörter eines Gedichts als seine eigenen. Später verläßt die Lyrik die Grenzen ihrer Sprache und auch der Übersetzer überschreitet eine Grenze, indem er übersetzt. Er ist in seiner Sprache Leser und Dichter zugleich. Das Wort translatio bedeutet ursprünglich Hinübertragen, Hinüberbringen. Das Wichtigste geschieht also in der Bewegung und in der Überschreitung, in der Transzendierung, und der Übersetzer ist derjenige, der die Ware über die Grenze bringt, derjenige, der selbst bei größter moralischer Integrität mehr transportiert, als in den Frachtpapieren steht, der – ob er will oder nicht – zum Schmuggler wird.
4. Natürlich hat Frost recht: Der Übersetzer verliert einen Teil seines Schmuggelguts, ein Teil wird ihm an der Grenze abgenommen, ein Teil verflüchtigt sich von selbst. Außerdem muß er Zoll zahlen. Bisweilen ist die Entfernung, die überwunden werden muß, zu groß, und damit meine ich nicht nur die Sprachen, die durch Meere, Gebirge und Ozeane voneinander getrennt sind, sondern auch die Zeit, zumal wenn etwa in unseren Tagen ein Übersetzer aus unbekannten, zweifelhaften Gründen beschließt, ein Gedicht aus dem 16. Jahrhundert zu übersetzen. Zum Glück – auch zu seinem eigenen – merkt der Übersetzer oft gar nicht, daß ihm etwas entging. Auch deshalb, weil unser ganzes Leben ab der Geburt das Resultat einer Subtraktion ist und der Verlust fest und selbstverständlich dazugehört. Frost hat auch insofern recht, als derartige Sentenzen etwas in sich tragen, das auch ein Merkmal von Poesie ist – sie sind ebenso universell wie hermetisch, sie sollen uns verführen. Ihr Sinn entzieht sich uns, als läge er jenseits der Zeilen, doch sie bezaubern uns durch ihre Anmut, sie wecken unsere Neugier, sie wollen entdeckt werden, wollen, daß wir ihnen folgen. Immer in der Nähe, immer einen Schritt voraus. Frosts Satz ist wie die Poesie, von der er spricht. Sie ist das, was verlorengeht, was wir verlieren, was sich uns entzieht, was in ständiger Bewegung ist. Und wir laufen immer hinterher. Doch wenn die Poesie das ist, was in der Übersetzung verlorengeht, dann müßte man, um sie wiederzufinden, eine Subtraktion durchführen, das heißt Original und Übersetzung vergleichen. Also – welch absurde Operation – die Übersetzung vom Original abziehen, und was übrigbliebe, wäre die Poesie. Nur was sollte das sein? Der Klang? Die Musik? Die Stimme? Der Kontext? Die Geschichte? Die Erfahrung? Das Leben des Autors? Die Geschichte der Sprache, in der er das Gedicht schrieb? Die Summe seiner Lektüren, die Momente der Begeisterung oder der Langeweile beim Lesen oder Hören fremder Texte? All seine Vormittage? All seine Nächte? All seine Feinde und all seine Lieben? Daß er blind war? Daß er hinkte? Daß seine Nachbarn ihn für einen Besessenen hielten? Daß er ein italienisches Mädchen war, das im Lyon des 16. Jahrhunderts auf italienisch schrieb? Daß er der russischsprachige Sohn eines jüdischen Tuchhändlers aus Warschau war? Der Enkel schwarzhäutiger Sklaven, die auf die Antillen verkauft worden waren? Eine Hofdame im Japan des 11. Jahrhunderts? Ja, all das und vieles mehr. Kurzum alles, was sich nicht übersetzen läßt. Wir können aber auch annehmen, das Leben eines Autors sei wenig relevant oder der Autor sei ganz einfach tot und es lebten nur die Originale seiner Gedichte. So sollte es doch eigentlich sein, oder? Was also geht in der Übersetzung verloren? Der Klang? Der Kontext? Die Stimme? Die Historie? Die Geschichte der Sprache, die erklingt, und das Besondere der in ihr gesagten Worte, deren versteckte Bedeutungen und emotionale Aufladungen? Wie, wie oft und von wem sie zuvor benutzt wurden, in welchem anderen Gedicht und in welchem Lied, das abends auf dem Balkon gesungen wird? Oder daß sie eben noch nie in einem solchen Kontext benutzt wurden? Und schon ist nicht mehr der Autor wichtig, sondern der Leser dieser Gedichte: sein Leben, seine Vormittage und Nächte, seine Lektüren und Lieben, seine Krankheiten und Obsessionen. Daß er die Tochter eines Immigranten aus einem armen, vom Krieg zerstörten Land ist. Daß er eine Brille mit sehr dicken Gläsern tragen muß. Daß er Hunde lieber mag als Katzen. Jedesmal spricht ihn die Lyrik auf andere Weise an, weil er ihr jedesmal eine andere Stimme gibt. Jeder einzelne Lektüreakt ist anders, einzigartig, und diese Einzigartigkeit hat wenig mit dem Wörterbuch zu tun, sie spielt sich anderswo ab, neben den Wörtern, vielleicht über ihnen. Vereinfacht können wir sagen: in der Psyche des Lesers oder, wenn wir das griechische Wort übersetzen, in seiner Seele. Im geistigen Raum. Derlei kann man schwerlich einpacken und über die Grenze transportieren und gleichzeitig hoffen, daß sich unterwegs nichts davon verflüchtigt.
Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann
SINN UND FORM 2/2021, S. 240-248, hier S. 240-242
