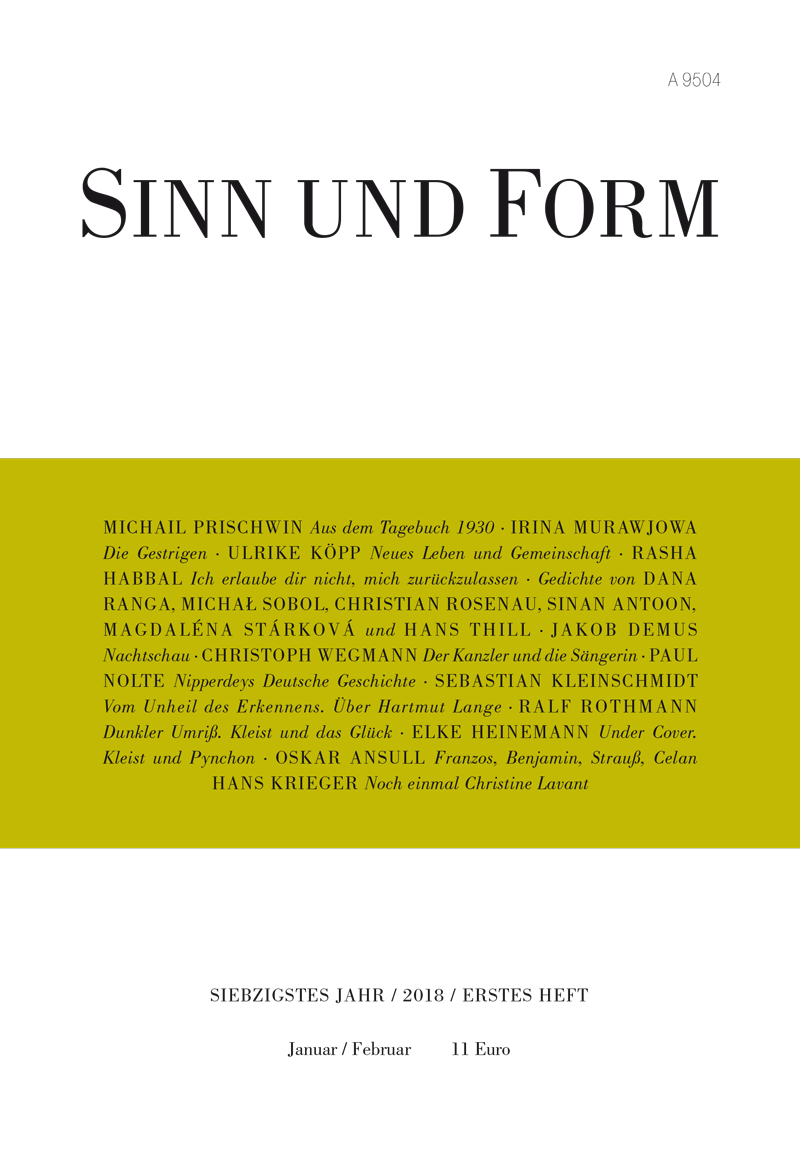Leseprobe aus Heft 1/2018
Köpp, Ulrike
Neues Leben und Gemeinschaft. Zum Reformstreben in der Moderne
Die Stalinallee, jene für ihre Architektur bewunderte wie verhöhnte Prachtstraße in der östlichen Mitte Berlins, ist eine Chiffre für den hoffnungsvollen Kurs zum Aufbau des Sozialismus wie auch für die existentielle Krise der Deutschen Demokratischen Republik im Juni 1953. Der sozialistische Boulevard sollte Arbeitern und ihren Familien großzügige, lichte Wohnungen bieten, mit Ladenzeilen die industrielle Leistungsfähigkeit des Landes demonstrieren und den Bewohnern mit einer Vielfalt gediegener Konsumgüter ein gutes Leben verheißen. In der Vorstellung der Planer gehörten dazu neben Geschäften für Jenaer Glas, für Schuhe und Bekleidung auch eine großzügige Buchhandlung und zwei Reformhäuser. Deren Einrichtung war im Rat des Stadtbezirkes unumstritten. Ganz anders die Frage, ob man auch dem Verkauf von Antiquitäten und Pelzwaren stattgeben solle, galten diese doch als Luxusgüter und standen für eine Gesellschaft der sozialen Ungleichheit, welche die DDR als Gesellschaft der Gleichen überwinden wollte. An den Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommenen Reformhäusern störte sich aber niemand, sie gehörten zum städtischen Leben und Einkaufen dazu wie Werbeanzeigen für Säfte oder Margarine aus der Reformsiedlung Eden bei Oranienburg. Die Ideen und Praktiken der um 1900 entstandenen Lebensreformbewegung waren inzwischen ganz selbstverständlich in den Alltag der Leute eingegangen. Auch für mich gehörten die Reformhäuser mit ihren braunen Holzregalen seit meiner Kindheit zum Inventar der Städte. Erst auf der Suche nach den Adern der Lebensreform in der DDR im Archiv stieß ich auch auf institutionelle Widerstände gegen diese Bestrebungen. Hinter den Kulissen gab es sogar den Versuch, den Gebrauch des Begriffs Reform für diese Handelseinrichtung zu unterbinden. Womöglich kam er von subalternen Mitarbeitern, die damit dem revolutionären Selbstverständnis der SED Genüge zu tun meinten. Bei dem Versuch sollte es dann aber auch bleiben.
Bei den Auseinandersetzungen um Praktiken der Lebensreform in den Nachkriegsjahren und der Frühzeit der DDR ging es immer auch um die Frage: Wie wollen wir leben nach diesem schrecklichen Krieg? Sein Ende wurde auch als Chance für einen kulturellen Neuanfang verstanden. Mit der Roten Armee kamen im Mai 1945 dessen Vorboten, die sowjetische Besatzungsmacht zirkelte den politischen Raum dafür ab: mit der Entnazifizierung der Behörden und Verwaltungen, mit der Bodenreform und der Enteignung der großen Unternehmen, die mit dem Krieg Gewinne gemacht hatten. Und ob die Deutschen sich nun als von den Faschisten Befreite fühlten oder als vom Feind Besiegte, sie nahmen diesen Raum ein und zeigten, daß selbst noch im radikalen historischen Bruch eine kulturelle Kontinuität waltet. Auch die Revolution von oben hat ihren Boden, der sie nährt.
Gleich im Sommer 1945 richtete der Magistrat von Groß-Berlin im Ressort Volksbildung eine Abteilung »Neues Leben« ein. Sie sollte »die Kulturarbeit des neuen Menschen« befördern. Mit Vorlesungen, Volkshochschulen und Ausstellungsführungen wollte sie den Berlinern geistige Anregung bieten. Tanz matineen, Gymnastik und Laienspielgruppen sollten für Unterhaltung und Entspannung der erschöpften Bevölkerung sorgen. Gesangs- und Sprechchöre wollte man auf die Beine stellen und mit ihnen die antifaschistisch-demokratische Politik des Magistrats unterstützen. Sogar um die Organisation von Reisen und Wanderungen wollte sich die Abteilung zusammen mit Jugend- und Tourismusvereinen kümmern. All diese Vorhaben erinnern an die Praxis der sozialdemokratischen Kulturarbeit in der Weimarer Republik. Der Mehrzahl der Berliner lagen freilich wohl die Unternehmungen weit näher, die sie mit der NS-Organisation »Kraft durch Freude« erlebt hatten. Diese aber hatte nur an das Freizeitkonzept der Arbeiterkulturbewegung vor 1933 angeknüpft, so wie nun auch die Antifaschisten, die zum Beispiel im Bezirk NO 55 die Bewohner zu einer ersten Silvesterfeier nach dem Krieg einluden. Man wolle das Jahr gemeinsam »in würdiger Form und froher Weise abschließen«, mit Freude und neuem Lebensmut. Die Einladung versprach ein kurzes Programm mit Rezitation und Gesang, ein Marionettenspiel mit dem Titel »Ein chinesisches Friedenslied« und Tanz in das neue Jahr hinein. Das Mehl und das Fett für die Pfannkuchen mußte allerdings jeder selber mitbringen.
Die Abteilung »Neues Leben« des Berliner Magistrats setzte auf alle, die trotz der Trümmerlandschaften wieder zu hoffen wagten. Mit Liederheften wollte sie die Gemeinschaft stärken, was schließlich not täte »beim nicht leichten Aufbauwerk «. Ein erstes Heft, »Lieder für Feier und Gemeinschaft«, erschien 1946. Es hob an mit »Freundschaft ist die Quelle wahrer Glückseligkeit«, einem Kanon von Beethoven, und ging weiter mit dem Volkslied »Die Gedanken sind frei« und dem Lied der Moorsoldaten, mit dem die Häftlinge des Konzentrationslagers Börgermoor ihr elendes Dasein zu überstehen versuchten. Der Grundton von Gemeinschaft erklang auch in den zukunftsgewissen deutschen Arbeiter und Jugendliedern wie »Wann wir schreiten Seit’ an Seit’« und in russischen Volksliedern. Ein zweites Liederheft hieß »Weisen von Abschied, Liebesfreud und Liebesleid«; der Verlag Neues Leben hatte sie offenbar sämtlich dem »Zupfgeigenhansl « entnommen, dem legendären Liederbuch der bürgerlichen Wandervögel. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte es Gymnasiasten und Studenten auf ihren kleinen Fluchten aus dem Alltag begleitet und ihnen geholfen, sich auf ihren Wanderungen als »neue Menschen« zu fühlen. Im »Zupfgeigenhansl« war demokratisches Liedgut über die Nazizeit hinweg aufbewahrt worden. Die ursprünglich darin enthaltenen Soldatenlieder hatte der Verlag allerdings nicht mehr abgedruckt. Den fröhlichen Marsch ins Feld zu besingen, danach war niemandem mehr zumute, schon nach dem Ersten Weltkrieg nicht und nun erst recht nicht mehr.
Wo sich 1945 in Ostdeutschland Hoffnung auf Gemeinschaft und ein neues Leben regte, reichte diese also bis an den Anfang des Jahrhunderts zurück. Der Soziologe Ferdinand Tönnies hatte den Begriff der Gemeinschaft 1887 in seiner Schrift »Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen« geprägt. Darin grenzte er die beiden sozialen Gebilde scharf voneinander ab. Er verklärte das naturwüchsige Leben in der traditionellen Dorfgemeinschaft zum Inbegriff harmonischen Daseins und sah die Gesellschaft als bloßes Nebeneinander entfremdeter Individuen. Tönnies hatte die mit den Gründerjahren sich rasant entwickelnde Industriegesellschaft vor Augen, die ihm allein auf »Egoismus«, auf »Begierde und Furcht« zu beruhen schien. Die Großstadt galt ihm »überhaupt als Verderben und der Tod des Volkes«. Seitdem entfaltete der Begriff der Gemeinschaft eine geradezu magische Kraft. Denn die Bewohner der großen Städte übernahmen ihn und übertrugen ihn auf ihre Bedürfnisse. Sie lösten ihn von seinem Ursprung, der dörflichen Zwangsgemeinschaft, und wendeten ihn auf Gemeinschaftsformen an, die sich innerhalb der kritisierten Gesellschaft eröffneten. Die in die Moderne Entlassenen erfanden sich ihre Gemeinschaft, wählten sie je nach Lebenslage, Interessen und Neigungen. Wie die Wandervögel, die Gymnasiasten und Studenten, die am Wochenende »auf Fahrt« gingen und dabei ihr Anderssein kultivierten und sich als Neue Menschen stilisierten. Oder wie die ehemaligen Tagelöhner und Mägde, die in die Städte gezogen waren, wo sie die Fabriken und Wohnverhältnisse als Fluch erlebten. Sie fanden mit ihresgleichen neue Zugehörigkeit, die Geselligkeit in der Kneipe, die Ausfahrt am Sonntag oder den solidarischen Zusammenhalt im Arbeitskampf um höhere Löhne.
Nicht selten war die Erkundung alternativer Lebensformen mit der Suche nach Antworten auf die »soziale Frage« oder »die Arbeiterfrage« verbunden, zeitgenössische Kürzel für die Mißstände der kapitalistischen Gesellschaft und die Hoffnung auf Besserung im Sinne des Sozialismus. Auch der Untertitel der ersten Ausgabe von Tönnies’ »Gemeinschaft und Gesellschaft«, der noch die Begriffe von »Communismus und Socialismus« enthielt, ist nur ein Indiz dafür, wie virulent sozialistische Vorstellungen waren und wie eng die verschiedenen politischen und kulturellen Bestrebungen im Ausgang des 19. Jahrhunderts zusammenhingen. Das Wissen darum ist freilich im 20. Jahrhundert verlorengegangen. Die geschichtlichen und sozialen Entwicklungen trennten sie, nicht zuletzt die großen Kriege. Und eine akademische Geschichtsschreibung, die dem Gang der Ereignisse politisch befangen, wenn nicht ideologisch verblendet nur auf bestimmten Pfaden folgt.
(…)
SINN UND FORM 1/2018, S. 46-60, hier S. 46-49