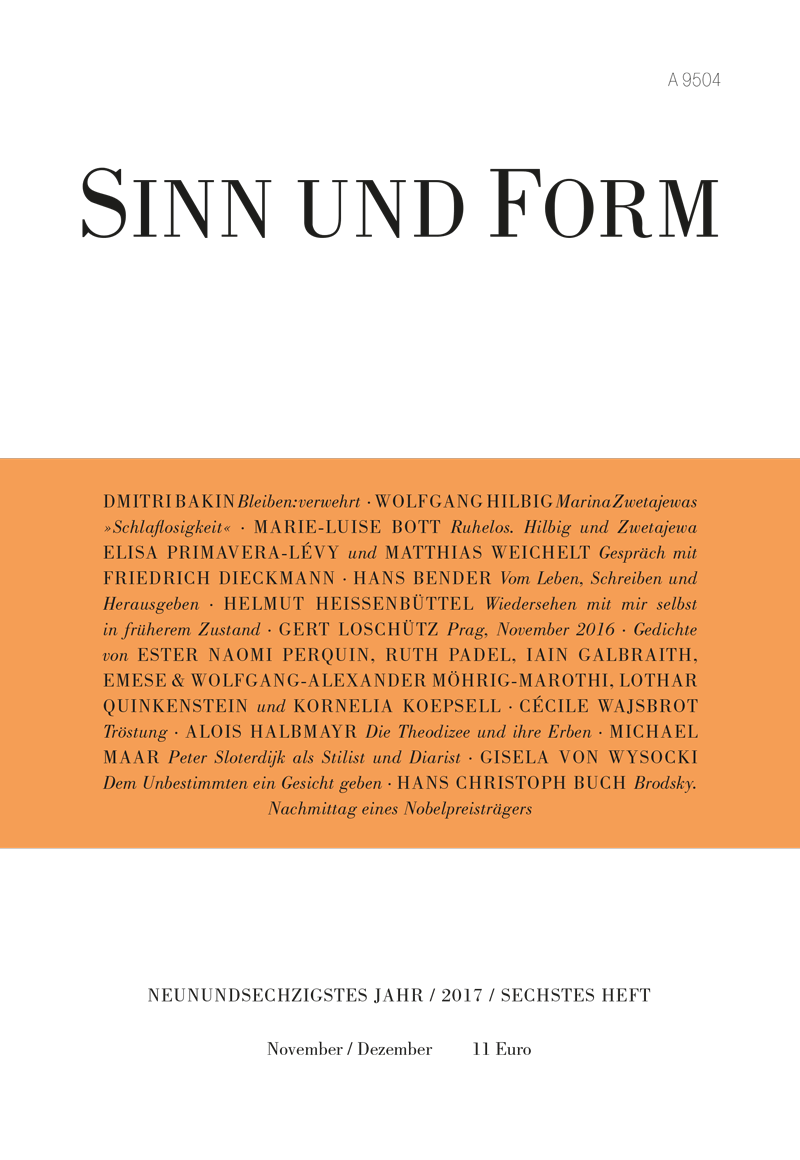Leseprobe aus Heft 6/2017
Heißenbüttel, Helmut
Wiedersehen mit mir selbst in früherem Zustand. Knut Hamsun: Das letzte Kapitel
Aus dem Archiv der Akademie der Künste
Als ich vor einiger Zeit im Schaufenster eines Antiquariats ein Buch von Svend Fleuron sah, war es, im Bruchteil von Sekunden eigentlich, genau in dem Moment, in dem ich Titel und Autor bewußt identifizierte, als ob ich weit zurück in die Zeit entführt würde, ins Vergangene, das bis zu diesem Moment ein Vergessenes gewesen war. Ich sah mich selbst, wie alt? sechs? sieben? acht? in einem großen Raum stehen, neben meinem Vater, der etwa Mitte Dreißig gewesen sein muß. Er beugte sich dem Schalterfenster zu, vor dem er stand, gab einen Zettel ab und bekam nach einer Weile eins oder mehrere Bücher durch den Schalter zugeschoben. Ich hatte meinen Vater in die öffentliche Bücherei begleitet, so würde ich heute sagen, wo er Bücher lieh, die er lesen wollte, und darunter waren auch solche von Svend Fleuron. Daß ich an einem dieser Titel, den ich als »Strix der Uhu« erinnere, hängenblieb, daß gerade er Erinnerung weckte, muß daran gelegen haben, daß er innerhalb der Familie sprichwörtlich verwendet wurde.
Worum geht es, wenn ich ein solches und in vielen Punkten sehr unscharfes Erinnerungsbruchstück rekapituliere? Nicht um die Fakten. Mein Vater stammte vom Lande, war ein Liebhaber von Natur- und Tierschilderungen, ich selber habe mit »Mümmelmann« von Hermann Löns lesen gelernt. Das hat sich, was meinen Vater betrifft, bis zu seinem Tod gehalten und nur wenig in Richtungen verlagert, die wiederum von meiner Leseneugier beeinflußt waren, das hat sich, was mich betrifft, weit weg bewegt, wenn auch gerade da, wo ich am fernsten Punkt angelangt schien, wiederum etwas von jenem Alten auftauchte, es ist, in einem ganz bestimmten Sinn und unumkehrbar, autobiographisch geworden. Das Auftauchen und die Identifikation eines solchen Titels im Schaufenster eines Antiquariats, heißt das, bringt nicht einen Prozeß in Gang, der auch nur entfernt mit literarischen, ästhetischen oder kritischen Gesichtspunkten zu tun hat, sondern Klappen lockert in meinem inneren Computer, so daß er Daten zur Verfügung stellt, die nicht Fakten, sondern Bilder, Geräusche, Gerüche, ja Ahnungen sind.
Will ich also die Lektüre von Büchern, die frühe, kindliche vor allem, auf eine Stufe stellen mit Schlagern, Gerüchen, Landschaftserinnerungen, Stimmen, Bildern? Lesen nichts anderes als etwas, das sich mit den Zufällen dieses oder jenes Lebensalters, dieser oder jener besonderen Phase der Entwicklung verbunden hat und nun mithelfen kann, das Vergangene zu reproduzieren? Nicht bloß mich daran zu erinnern, denn das hat ja auch seine mechanische Seite, von der dem Gedächtnis, gleichsam auswendig gelernt, gesagt wird, das war so oder so, sondern es wiedererscheinen zu lassen, eben in dem Sinne, in dem die Psychoanalyse von Reproduktion spricht? Was wiedererscheinen zu lassen? Was erscheint denn da, was halluziniert sich mir?
Das sind vorgreifende Fragen, und ich will vor allem eins nicht, sie vorauf beantworten. Denn auch dies, dies Fragenstellen ohne Antwort, gehört zu dem Versuch, etwas auf die Spur zu kommen, was sich im allgemeinen allzu rasch unter gängigen Floskeln verbirgt oder dahin zurückzieht. Der Titel eines im Schaufenster eines Antiquariats entdeckten Buchs ruft fast unmittelbar ein bestimmtes Erinnerungsbild wach. Wenn ich das Bild zu durchdringen versuche, schwemmt anderes herauf, es bildet sich eine Kette, die wiederum nach allen Seiten ausstrahlt, es entsteht ein Geflecht, in das ich mich zurücksinken lassen kann, in dem ich etwas zu haben glaube, das einmal war, das sich nur im Speicher meines Gedächtnisses abgebildet hat, dessen Details wie Zusammenhänge ich aber niemals im Sinne einer nachprüfbaren Faktizität, Datierung oder Feststellung sicher sein kann, denn es sind nur Bilder.
Indem ich so weiterzukommen versuche, rede ich aber nicht nur über den phänomenologischen Prozeß der Erinnerung, mache ich nicht nur, mag sein, täppische philosophische Stolperschritte, sondern ich rede zugleich auch schon über etwas, was das betrifft, durch das mein Versuch in Gang gebracht worden ist. Ist denn nicht Schrei ben, Dichten, Bücher-Verfassen schon von sich aus so etwas wie dieses Festhalten von dem, was sich gar nicht halten läßt, unaufhörlich verrinnt? Und ich brauche hier gar nicht Marcel Prousts »Suche nach der verlorenen Zeit« zu bemühen, die ja nur wortwörtlich zu fassen sucht, was auch sonst Literatur bestimmt, ich brauche nur einen Augenblick zu überlegen, was denn für mich, und da kann ich nur wieder ganz und gar subjektiv sein, der Unterschied ist zwischen den Märchen der Brüder Grimm, dem »Rübezahl« von Musäus, dem »Wirtshaus im Spessart« von Wilhelm Hauff oder den Kasperlstücken von Franz Pocci. Und das ist nicht etwas, das Inhalt, Stoff, Erzählweise, Stil betrifft, die Unterschiede lassen sich wiederum nur in Bildern, Assoziationen, Gerüchen, Erinnerungen beschreiben.
Ich will das, was diese Märchen angeht, nicht weiter ausführen, obwohl sich da für mich ein ganzes weites Panorama öffnet, in dem ich völlig andere Dinge sehe, völlig andere Empfindungen habe, wenn ich Rübezahl folge oder dem Fischer und seiner Frau oder Jorinde und Joringel oder dem Zwerg Nase oder vor mich hin sage: »Spißi, spaßi, Kasperladi, hicki, hacki, Carbonaci. Trenschi, transchi, Appetiti, fressi, frassi, fetti, fitti.« Worauf es mir ankommt, ist, diesen einen Punkt deutlich zu machen, daß ich nicht kritisch lesen kann, wenn Literatur selbst, von den Anfängen meiner Leseerfahrung an, ein Erinnerungsspeicher ist.
Da ich schon dabei bin. Ich weiß, daß ich an einem frühen Weihnachtsfest die »Schatzinsel« von Stevenson geschenkt bekam und gelesen habe. Dieses Buch ist später verlorengegangen. Ich lebe, wenn ich zurückdenke, in bestimmten Erlebnissen, sinnlichen Eindrücken, Schaudern, Ängsten, Überraschungen, Freuden, fast, als sei das, auf irgendeinem Abweg, eigenes Erlebnis gewesen. Spät erst habe ich versucht, die »Schatzinsel« wiederzulesen. Ich fand nichts darin von dem, das ich erinnerte. Nicht nur war der innere Glanz verlorengegangen, es war ein anderes Buch. Die Erzählung hat sich mir eingeprägt wie ein Traum, der jedoch in dem Text, der einst diesen Traum ausgebildet hat, nicht wiedererkennbar ist. In meiner frühen Schulzeit gab es etwas, das sich »Deutsche Jugendbücherei « nannte, herausgegeben vom Dürer-Bund, das waren Hefte von 32 Seiten Umfang, Novellen, Ausschnitte, Berichte aus Wissensgebieten für Jugendliche. Dort las ich über eine Forschungsreise in Tibet von Wilhelm Filchner. Um die gleiche Zeit muß meine Mutter mir zum erstenmal ein Mittel gegen Erkältungen gegeben haben, das sich Rheila-Perlen nennt. Auch heute noch, wenn ich Rheila-Perlen lutsche, befinde ich mich, automatisch, in Tibet.
Einem Tibet natürlich, das es, in der sogenannten realen Welt, nie gegeben, das sich allein in mir, in meiner Phantasie, ausgebildet hat. Umgekehrt ist es das, was in den Versuchen, Realität in Sprache, in Zeichen für Bilder und Vorstellungen, also in Phantasie zu verwandeln, die Literatur bestimmt, das eigentlich Literarische ausmacht. Ich habe also nicht auf der einen Seite etwas Eindeutiges, das dann durch den Filter des Lesens hindurchgeht und auf der anderen Seite wiederum als etwas Eindeutiges, Lesefrucht, Eindruck, Begeisterung, Entrückung, kritisches Bewußtsein usw. herauskommt. Sondern die Wechselbeziehung zwischen dem, was in die Literatur einfließt, und dem, was sich mir mitteilt und was sie in mir bewirkt, in mir anregt, verstört, öffnet, was aber auch mit Hilfe der Literatur an innerer Landschaft gebildet, erfahren und wiedererfahren werden kann, ist von äußerster Zweideutigkeit, in seinen wechselweisen Einflüssen und Prozessen oft nur schwer zu durchschauen und beschreibbar manchmal nur, indem man, auf zweiter Ebene sozusagen, Literatur daraus macht.
(…)
SINN UND FORM 6/2017, S. 786-794, hier S. 786-788