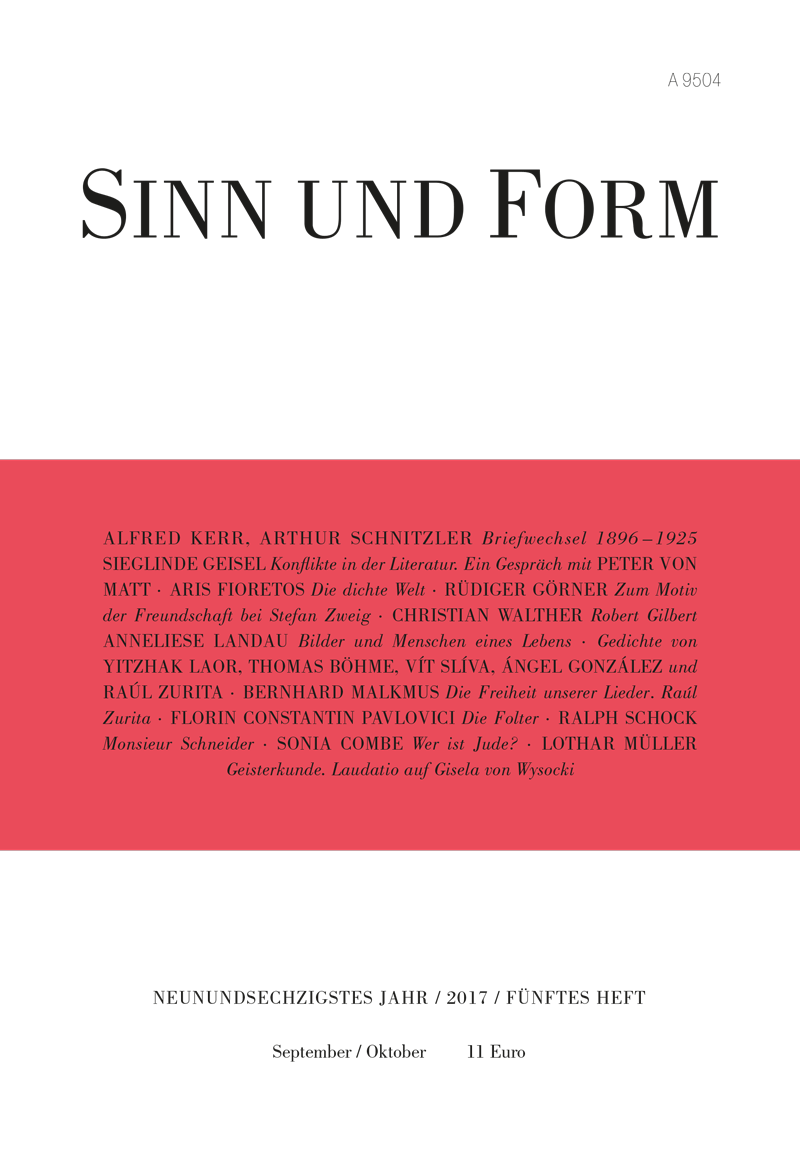Leseprobe aus Heft 5/2017
Kerr, Alfred
»Es ist eine sehr seltsame Gefühlsmischung, die Sie erwecken«. Briefwechsel mit Arthur Schnitzler 1896-1925
Vorbemerkung
Als 1984 der zweite Band der Briefe Arthur Schnitzlers erschien, hieß es im Vorwort: »Obwohl Schnitzler es fast immer ablehnt, eigene Werke zu interpretieren, gibt es dennoch Briefe, die über seine inhaltlichen und ästhetischen Intentionen einigen Aufschluß geben.« Unter den fünf Adressaten, die solche Schreiben erhielten, war der Kritiker Alfred Kerr. Dabei lagen den Herausgebern gerade einmal vier Briefe an diesen vor, von denen sie drei veröffentlichten.
Bis 2013 besaß das Alfred-Kerr-Archiv der Akademie der Künste nur Schnitzlers letztes Schreiben an Kerr von 1925. Der Großteil der restlichen Briefe galt jahrzehntelang als verschollen. Als Kerr 1933 mit seiner Familie aus Deutschland fliehen mußte, wurde der größte Teil seines Besitzes konfisziert, darunter auch die Schnitzler-Briefe. In einem Zwischenlager der Gestapo nahm eine literaturinteressierte, vielleicht auch Schnitzler verehrende Sekretärin die Briefe an sich. Nach dem Krieg wagte sie nicht, mit ihrem »Fund« an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie vererbte die wertvollen Autographen ihrem Neffen, der sie 2013 einem Auktionshaus anbot. Nach Absprache mit der Familie Kerrs, den rechtmäßigen Eigentümern der Briefe, konnte die Akademie ein Vorkaufsangebot aushandeln und die Manuskripte erwerben.
Die Kerr-Autographen wiederum werden seit 1938 in Cambridge betreut. Schnitzlers Haus in Wien, in dem die Familie auch nach seinem Tod 1931 wohnte, wurde beim deutschen Einmarsch 1938 beschlagnahmt und versiegelt. Auf Initiative eines gerade in der Stadt befindlichen Studenten der University of Cambridge wurde der Nachlaß mit Einverständnis der Familie und mit Hilfe der englischen Botschaft nach England gebracht. Die vorliegenden 49 Briefe bzw. Karten Schnitzlers und 42 Schriftstücke Kerrs, aus denen hier eine umfangreiche Auswahl abgedruckt wird, sind bis auf wenige Ausnahmen unveröffentlicht.
Der Briefwechsel zwischen Arthur Schnitzler und Alfred Kerr setzte 1896 ein. Beide waren sich zwei Jahre zuvor bei einer Geburtstagsfeier der Mutter von Adele Sandrock, Schnitzlers damaliger Freundin, vermutlich zum ersten Mal begegnet. Ein halbes Jahr später schrieb Kerr in einer Kritik, wie Schnitzler in seinem Tagebuch vom 4. Dezember 1894 vermerkte, »über die ›entzückenden Anatoldramen und ein schmerzliches poesievolles Stück Märchen‹«. Autor und Kritiker waren zu diesem Zeitpunkt etwa dreißig Jahre alt und standen kurz vor ihrem Durchbruch in der literarischen Welt. Kerr, 1867 als Alfred Kempner in Breslau geboren und in einer akkulturiert-jüdischen Weinhändlerfamilie aufgewachsen, war in Berlin bei dem bekannten Germanisten Erich Schmidt promoviert worden. 1893 erschien im »Magazin für Litteratur« seine erste Theaterkritik, ab 1895 verfaßte er wöchentlich »Berliner Briefe«, u. a. für die »Breslauer Zeitung«, die auch in Berlin gelesen wurde. Darin schrieb er über Literatur, Theater, Ausstellungen, Reisen und das Alltagsleben.
Schnitzler wurde 1862 in Wien in eine jüdische Ärztefamilie hineingeboren. Er studierte ebenfalls Medizin, arbeitete nach seiner Promotion zum Doktor med. bis 1888 im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (wo auch der Neurologe Sigmund Freud praktizierte) und wechselte dann als Assistent seines Vaters an die Allgemeine Poliklinik. Nach dessen Tod 1893 eröffnete er eine Privatpraxis. Er wollte literarisch tätig sein und sah diese vor allem als Mittel zum Zweck des Lebensunterhalts. Mit zunehmendem schriftstellerischem Erfolg reduzierte er den Praxisbetrieb, gab ihn aber nie ganz auf.
1891 schloß Schnitzler sich der literarischen Vereinigung »Jung-Wien« an, wo er Richard Beer-Hofmann, Hermann Bahr, Felix Salten, Gustav Schwarzkopf und Paul Goldmann kennenlernte – sowie den siebzehnjährigen Hugo von Hofmannsthal, der sich »Loris« nannte. Die Gruppe wandte sich vom Naturalismus ab und wurde zur wichtigsten literarischen Bewegung der österreichischen Moderne. Schnitzler ragte durch sein psychologisches Einfühlungsvermögen hervor, besonders in den frühen Texten verarbeitete er auch eigene Erlebnisse. Schon bald wurde er mit den »Anatol"-Szenen einem größeren Publikum bekannt. Seine vielbeachtete Novelle »Sterben« erschien 1894 in der »Neuen Deutschen Rundschau«, die aus der »Freien Bühne« hervorgegangen war. Deren Gründer Otto Brahm war auch Intendant des Deutschen Theaters Berlin und führte am 4. Februar 1896 Schnitzlers Schauspiel »Liebelei« erstmals in Deutschland auf, mit populären Darstellern wie Agnes Sorma, die im ersten Brief an Kerr erwähnt wird. Schnitzler reiste zu den Endproben an, ärgerte sich, verhandelte mit dem Regisseur, machte letzte Textänderungen, prüfte die Publikumsreaktionen bei der Premiere und feierte hinterher mit Theaterleuten und Journalisten, darunter Alfred Kerr.
Zu diesem Zeitpunkt hatten beide schon eine gewisse Bekanntheit erreicht. Drei Tage später, am 7. Februar, begann der sich über einen Zeitraum von 29 Jahren erstreckende Briefwechsel. Er setzt ein mit zwei der typischen kurzen Brieflein, die beide sich schrieben, wenn sie in derselben Stadt waren und ein Treffen vereinbaren wollten, und die kaum mehr als Ort und Zeit enthielten. Die Stadt war meist Berlin, der Wohnort Alfred Kerrs; manchmal aber auch Wien, wo Arthur Schnitzler lebte. Verabredungsbriefe könnte man sie nennen – und dazu auch die Briefe zählen, die beide sich schickten, wenn sie auf Reisen waren und sich unterwegs ein Treffen erhofften. Besonders viele dieser Verabredungsbriefe wurden 1900 gewechselt – im Vorfeld einer Alpenwanderung, die sie mit Paul Goldmann, Richard Beer-Hofmann und Leo Van-Jung unternahmen.
Im ersten Brieflein von 1896 schickte Kerr mit »ergebenstem Gruß« Terminvorschläge an den »Verehrte(n) Herr(n) Schnitzler«. Dieser antwortete noch am selben Tag aus seinem Hotel dem »Geehrte(n) Herr(n) Kerr« und unterzeichnete mit »Ihr ergebener Arth Schn«. Adressiert war der Brief an »Herrn Alfred Kerr / Schriftsteller«. Schwingt darin ein wenig Ironie mit? Im nächsten Brief spricht Schnitzler lieber vom »Verhältnis zwischen Autor und Kritiker«. In bezug auf Kerr ist mit der Bezeichnung »Schriftsteller« aber schon etwas Wesentliches gesagt. Der aufstrebende Theaterkritiker, der inzwischen auch für die »Neue Deutsche Rundschau« und die Wochenschrift »Die Nation« schrieb, hatte genau diesen Anspruch an sich. 1905, im Vorwort seiner Gesammelten Schriften »Das neue Drama«, sprach er es deutlich aus: »Der wahre Kritiker bleibt ein Dichter: ein Gestalter. (…) Wert hat, wie ich glaube, nur Kritik, die in sich ein Kunstwerk gibt: so daß sie noch auf Menschen wirken kann, wenn ihre Inhalte falsch geworden sind. Die Kritik, die als eine Dichtungsart anzusehen ist.«
In der 1917 erschienenen fünfbändigen Ausgabe seiner Schriften, »Die Welt im Drama«, bekräftigte Kerr seine Auffassung von der Kritik als vierter Kunstform neben Epik, Lyrik und Dramatik und erklärte sich selbst zum Schriftsteller. Aus den 48 (!) Paragraphen des Vorworts spricht, man kann es nicht anders sagen, leichter Größenwahn: »ihr fühlt, daß in der Entwicklung der Menschensprache hier ein Kilometerstein unverwechselbar leuchtet«. Und er sorgt auch für den Fall des ausbleibenden Erfolges vor: »Sei ein Jahrhundertschriftsteller und arbeite ständig auch an Zeitungen (…) die Zeit ist kaum dafür.«
Ende August 1896 besuchte Kerr Schnitzler in Wien. Die Briefanreden in dieser Phase bezeugen die enger werdende Beziehung: »Liebster Herr Schnitzler« und »Mein lieber Doctor Kerr« heißt es schon im Januar 1897. Die gegenseitige Anrede »Lieber Freund« führt Schnitzler Anfang Februar 1900 ein, sie blieb über alle Konflikte und Pausen hinweg bis zu den letzten Briefen. Geduzt haben beide sich nicht, das vermied Schnitzler aber auch bei langjährigen und engen Freunden wie Schwarzkopf und Hofmannsthal. Bei den ersten Verabredungsbriefen blieb es jedenfalls nicht. Schon Schnitzlers Schreiben vom 19. März 1896, also kurz nach dem ersten Treffen, ist länger, inhaltsreicher. Er bedankt sich für einen Artikel in der »Neuen Deutschen Rundschau« – mit Abkürzungen und Andeutungen, in einer das Gelesene und die entstehende Beziehung psychologisch deutenden Sprache. Zu dieser zweiten Kategorie kann man 23 Briefe zählen: 15 von Schnitzler und 8 von Kerr. Solche Beziehungsbriefe, wie ich sie nennen möchte, sind bis zu sieben Seiten lang. Und sie sind die entscheidenden: Es geht um die Freundschaft, um Gefühle und Befindlichkeiten, um das Schrei ben, um (meist sehr emotionale) Reaktionen auf Schnitzlers Stücke bzw. Kerrs Kritiken. Kerr bewunderte Schnitzlers frühe Werke. Dieser war angesichts seines sonst schwierigen Verhältnisses zur Kritik erfreut über die kundige Anteilnahme. Er wollte verstanden werden.
Schnitzlers Stück »Freiwild«, in dem der Duell-Kodex des österreichischen Militärs kritisiert wird, wurde am 3. November 1896 im Deutschen Theater Berlin uraufgeführt. Während seines Aufenthalts traf Schnitzler Kerr eine Woche lang täglich. Beide waren nicht nur bei der Premiere, sondern auch bei zahlreichen Besuchen, Treffen und Mahlzeiten zusammen, meist in größeren Runden wie bei Oscar Bie, dem Herausgeber der »Neuen Deutschen Rundschau«. Am 5. November notierte Schnitzler in seinem Tagebuch: »Bei Bie. Dort Kerr; von meinem Stück nicht befriedigt; ähnliche Ansichten wie ich.« Hier deutet sich ein Muster an, das in den Briefen häufig wiederkehrt. Kerr kritisiert Schnitzlers Texte, und der sich selbst gegenüber äußerst kritische Schnitzler stimmt zu. Einige Male versucht der Autor, bestimmte Motive und Figurenkonstellationen vorsichtig zu erklären; manchmal wirbt er geradezu um Verständnis. So kommt es zu den für Schnitzler so seltenen Aussagen darüber, wie er schreibt. 1904 war in dieser Hinsicht das ertragreichste Jahr. Über Entstehung und Aufbau seiner Dramen »Der einsame Weg« und »Der Schleier der Beatrice« – letzteres heute vergessen, von Schnitzler selbst aber geschätzt – gab der Verfasser ausführlich Auskunft. Privates hingegen wird selten besprochen. Wie Kerrs Leben in dieser Zeit verlief, läßt sich in der 2016 erschienenen Kerr-Biographie von Deborah Vietor–Engländer nachlesen.
Um 1905 war Kerr als Essayist beliebt und als Kritiker gefürchtet; sein Ansehen stand dem Schnitzlers nicht nach. Trotzdem schlich sich in ihre Beziehung ein Ungleichgewicht ein. Wenn Schnitzler sich vorsichtig gegen eine Einschätzung Kerrs wehrte, entstanden Pausen in der Korrespondenz, schien ein Abbruch des Kontakts zu drohen. Eine Frage des Selbstbewußtseins? Schnitzler schien es in die Wiege gelegt worden zu sein, Kerr mußte es sich wieder und wieder erkämpfen. Hatte Kerr von der Schriftstellerkarriere geträumt, um die er Schnitzler beneidete? Schaut man sich seine Besprechungen von dessen Dramen an, drängt sich die Vermutung auf, daß der Kritiker den Schriftsteller auf mehr oder weniger subtile Art in die Schranken weisen wollte. Kerr vergab an Schnitzler Plätze in einem von ihm selbst ausgerufenen Wettbewerb mit anderen Schriftstellern. Dabei verhielt sich Kerr ambivalent: Lob und Kritik verkehrten sich zuweilen in ihr Gegenteil. Ein über ein Jahr lang angekündigter Artikel über Hofmannsthal und Schnitzler, nach dem letzterer immer wieder fragte, erschien schließlich im Juni 1900 in der »Neuen Deutschen Rundschau«. Von den sieben Abschnitten des sechsseitigen Textes (wie fast immer durch römische Zahlen gegliedert, Kerrs Markenzeichen) befaßt sich nur der letzte auf einer halben Seite mit Schnitzler, alles Vorangegangene galt Hugo von Hofmannsthal. Daß dieser erste Teil auch noch »fast panegyrisch« ausfiel, entschuldigt der Verfasser schon vor Erscheinen gegenüber Schnitzler als »Sympathie ohne Herzlichkeit «. Der zunächst dürftig wirkende letzte Abschnitt von »Aus der Wiener Mappe« galt allerdings einem unveröffentlichten Text, dem skandalumwobenen und von der Zensur lange verhinderten »Reigen«. So war selbst diese halbe Heftseite eine Ermutigung, und Schnitzler reagierte entsprechend erfreut. In einem ausführlichen Artikel in der »Neuen Deutschen Rundschau«, der nach der Uraufführung von Schnitzlers Schauspiel »Der einsame Weg« 1904 erschien und die Premiere des »Schleiers der Beatrice« mit einbezog, urteilte Kerr hingegen: »Die Beatrice und dieses Schauspiel mit ihrem tiefen Sinn für etliche Beziehungen des Daseins (…) stehen in Deutschland doch ohne Mittelglied hinter den Lebensstücken von Gerhart Hauptmann.« Was als Lob gedacht war, traf Schnitzler hart. In seinem nächsten Brief spricht er ungewöhnlich ausführlich über seine Gestaltung der Figuren und begründet selbstempfundene Mängel mit eigenen Charakterschwächen. Was ihn wirklich verletzt hatte, vertraute er aber nur seinem Tagebuch an: »Kritik Kerr (N. D. Rsch.) Eins. Weg; sehr günstig, mich doch an empfdl. Stellen treffend. – Stellt mich nach Hauptmann (mit Bea. und E. Weg) – dann lang nichts. – Wozu die Location. – Ich glaube wohl dass Hauptm. mehr Künstler ist als ich; – ahne aber, daß ich für später mehr werde zu bedeuten haben. –"
1905 erntete Schnitzlers Freund Richard Beer-Hofmann in der »Neuen Rundschau« Kerrs überschwengliches Lob für »Der Graf von Charolais«. Das Stück, eine Bearbeitung, wird eigentlich zerpflückt, die Sprachkunst des Verfassers aber in den Himmel gehoben: Der Artikel endet mit »Ave! –Ave! – Ave!« Im vorletzten Absatz, als Fazit, spricht Kerr von seiner Erschütterung: »Seit Gerhart Hauptmanns Landung hat in Deutschland keiner solche Worte gesprochen. (…) man spürt die Nähe des Unbeschreiblichen; (…) Hier wirkt eine verborgene Macht (…). Unter den Österreichern, die heute die Dichtung ihres Landes machen, steht Beer-Hofmann gesondert da. Ist er frei von snobistischer Kultur, die sich bei Hofmannsthal im strenger Eklektischen äußert, bei Schnitzler im Lebemanngestus (…)?« Letzterer setzte sich in seinem Tagebuch ausführlich damit auseinander. Er spürte Neid und verachtete sich dafür. Von Kerr spricht er als dem »berufensten Kritiker«. Kurz zuvor, Anfang Januar 1905, sah Schnitzler sich genötigt, in einem langen Brief auf eine Bemerkung Kerrs zu reagieren, die ihn herabwürdigte. Er war als Schriftsteller und Arzt um ein Gutachten in einer Plagiatsaffäre um Kerrs Konkurrenten Siegfried Jacobsohn gebeten worden und hatte diesem bescheinigt, möglicherweise unabsichtlich abgeschrieben zu haben, was Kerr wiederum absurd fand. Seine öffentliche Zurechtweisung Schnitzlers war ein herber Einschnitt – die Freundschaft war an ihrem Tiefpunkt angelangt.
Ab diesem Zeitpunkt kam kein rechter Austausch mehr zustande. Mehr als sieben Jahre, von Anfang 1911 bis Mitte 1918, wechselten beide keine Briefe mehr. Es gab nur gelegentliche Meldungen. Als passend dafür erwiesen sich Ansichtskarten – neben den Verabredungs- und den Beziehungsbriefen die dritte Korrespondenzform. Der Text war dabei naturgemäß kurz, außer Datum, Anrede und Unterschrift meist nur ein Gruß, manchmal auch mit Bemerkungen von Mitreisenden. Ansichtskarten schrieben sich Kerr und Schnitzler von Anfang an, aber in der mittleren Phase ihrer Beziehung wurde die Kürze symptomatisch und von beiden auch als Überrest eines vormals intensiveren Kontakts wahrgenommen. So heißt es im Sommer 1910 außer Gruß und Unterschrift auf den Karten nur noch »hier unser Jahresbriefwechsel« (Kerr) bzw. »›Briefwechsel‹ Kerr – Schnitzler, Band 16« (Schnitzler).
Auch Kerrs Kritiken zu Schnitzlers Werken bzw. Aufführungen wurden seltener. 1910 stellte er in einer Besprechung der späten Uraufführung des »Anatol"-Zyklus fest: »Der Arthur ist längst ein Klassiker geworden.« Aber Klassiker langweilten ihn. Er wollte Neues sehen, er wollte Entwicklung. Seine vereinzelten Schnitzler-Kritiken nach 1911 haben die Eigenart, immer einen grundsätzlich würdigenden Satz zu enthalten, sich ansonsten aber über den einst verehrten Schriftsteller fast lustig zu machen. Als im Mai 1917 in Berlin ein Schnitzler-Abend im Theater in der Königgrätzer Straße stattfand, rezensierte ihn Kerr mit einem seiner bissig-humorvollen Gedichte. »Aus friedlichen, verschollenen Zeiten / ragt wie ein dämmerndes Symbol / die Eleganz der Innigkeiten / des sucherischen Anatol (…) Der Held ist wählerischer, zarter / beim Artur!! (…) In Arturs Welt, vom Stil betaut / lacht man nicht so erfrischend laut.«
Könnte das nachlassende Interesse Kerrs daran liegen, daß er den Zenit im Schaffen seines österreichischen Freundes erreicht sah und auf die kommenden Stücke nicht mehr sonderlich gespannt war? Tatsächlich sind sich die Theaterhistoriker heute weitgehend einig, daß der Aufführung des Dramas »Professor Bernhardi« 1912 in Deutschland – in Österreich blieb es bis 1918 verboten – keine großen Theatererfolge Schnitzlers mehr folgten. Kerr erklärte nach Schnitzlers Tod »Professor Bernhardi« und Hauptmanns »Die Weber« zu den einzigen zwei Zeitstücken »von dauernder Kraft« und »mit Dichtungswert «, die er kenne. Im Erstaufführungsjahr hatte er nicht darauf reagiert. Dabei hätte es passende Publikationsmöglichkeiten durchaus gegeben. Kerr schrieb seit 1901 nicht nur für den »Tag«, sondern gab von 1912 bis 1915 auch eine eigene Zeitung heraus, an der er vorher schon zwei Jahre intensiv mitgearbeitet hatte: den »PAN«. Schaut man sich an, welche Rolle Schnitzler in diesem Unternehmen spielt, muß man sagen: keine. Texte von ihm wurden nicht veröffentlicht; angebotene Texte über ihn lehnte Kerr ab. Auch als 1917 Kerrs Gesammelte Schriften erschienen, waren nur wenige Schnitzler-Kritiken enthalten. Sechs Texte, geschrieben zwischen 1905 und 1915, abgedruckt auf 25 Seiten, immerhin versammelt in Band II, »Der Ewigkeitszug«; Band IV trägt den Titel »Eintagsfliegen « … »Come here, good dog!« steht als Motto zwischen der Überschrift »Arthur Schnitzler« und den nachfolgend aufgeführten Kritiken. Kerrs Text zur »Komödie der Worte« von 1915 ziert der Untertitel »Schnitzlers achtzigster Geburtstag«, was den bei Erscheinen des Buches tatsächlich erst Fünfundfünfzigjährigen gekränkt haben dürfte. In sein Tagebuch schrieb Schnitzler am 13. Februar 1918: »Nm. [Nachmittags] in Kerr (Welt im Drama) alles über mich gelesen. Anfangs hatte er ein schönes, später noch ein achtungsvolles Verhältnis zu mir – aber eigentlich begann sein Abfall sofort nach der Liebelei. Im Ganzen bleibt er, bei aller Geckerei, ein famoser und wahrhaft origineller Kerl. –"
1918 wollte der inzwischen fünfzigjährige Kerr heiraten; seine zukünftige Frau Inge Thormählen war dreißig Jahre jünger als er. Mit dem schönen Anlaß der Verlobung versuchte Schnitzler die alte Freundschaft wiederaufleben zu lassen. Im Brief vom 5. Juli 1918 sprach er, dessen Ehe sich gerade aufzulösen begann, sogar von Seelenverwandtschaft. Zur achtjährigen Unterbrechung der Korrespondenz äußerte er sich vorsichtig umschreibend. Zwei Jahre später, im Mai 1920, unternahm Schnitzler einen letzten Versuch: Zur zweiten Hochzeit Kerrs mit Julia Weismann – die erste Frau war ein Vierteljahr nach der Hochzeit an der Spanischen Grippe gestorben, Kerr hatte nur knapp überlebt – gratulierte er und äußerte die Hoffnung, man möge sich doch einmal wiedersehen. Alfred Kerr reagierte nicht. Erst als fünf Jahre später ein Aphorismus von Schnitzler über Kritik mit dem erfundenen Titel »Schnitzler über Kerr« in verschiedenen deutschen Tageszeitungen erschien, schickte Kerr einen Dreizeiler. Die Antwort Schnitzlers, in der er sich gegen die Titel-Text-Collage und eine beigefügte Glosse der Redaktion verwahrt, ist sieben Seiten lang. Hier spricht er so deutlich wie in keinem anderen Brief auch einmal Kritik an Kerr aus. »Endlich!« möchte man als Leser ausrufen. Aber damit endet der Briefwechsel zwischen Schnitzler und Kerr endgültig.
Arthur Schnitzler starb am 21. Oktober 1931 in seiner Heimatstadt Wien an einer Hirnblutung. Alfred Kerr würdigte und beschrieb in mehreren Artikeln, u. a. im »Berliner Tageblatt« vom 22. Oktober und einem Rundfunkvortrag am 8. November 1931, den verstorbenen »adligen Freund«: »Menschlich war Schnitzler (…) nicht sehr überströmend. Immer etwas präokkupiert – beschäftigt mit der Arbeit, die er vorhatte. (…) Wenn Schnitzler herzlich wurde, war es noch immer eine verhaltne Herzlichkeit. Auch in seinen guten Jahren.« Er würdigte Schnitzler als »Erweiterer des Wissens von der Seele« und bestätigte ihm ein »verborgenes Kämpfertum«, ein »Kämpfertum mit Grazie«. Kerr verteidigte den als »Erotiker« verkannten Schriftsteller, den man immer wieder auf die »süßen Mädel aus der Vorstadt« habe reduzieren wollen. Schnitzler sei ein Dichter gewesen, »der in seiner Sprache die Entwicklung vorwärts bringen half«. Als höchstes Lob rückte Kerr ihn sogar in die Nähe seines Idols Henrik Ibsen – und mehr als das: »Der Mann aus Wien, Schüler Ibsens, kam in Punkten über das Nordphänomen hinaus. (…) Was von ihm bleibt, ist ein deutscher Besitz. Ueber die darin verborgne Vielfalt ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.«
Arthur Schnitzlers Fazit steht in seinen (posthum erschienenen) »Aphorismen und Notaten«: »Allzuoft betont er, daß er nicht nur ein großer Kritiker, sondern auch ein größerer Dichter sei als die meisten derjenigen Autoren, über die er zu schreiben hat. Vielleicht hat er recht; aber er sollte das Urteil der Nachwelt überlassen.«
Elgin Helmstaedt
SINN UND FORM 5/2017, S. 581-618, hier S. 581-586