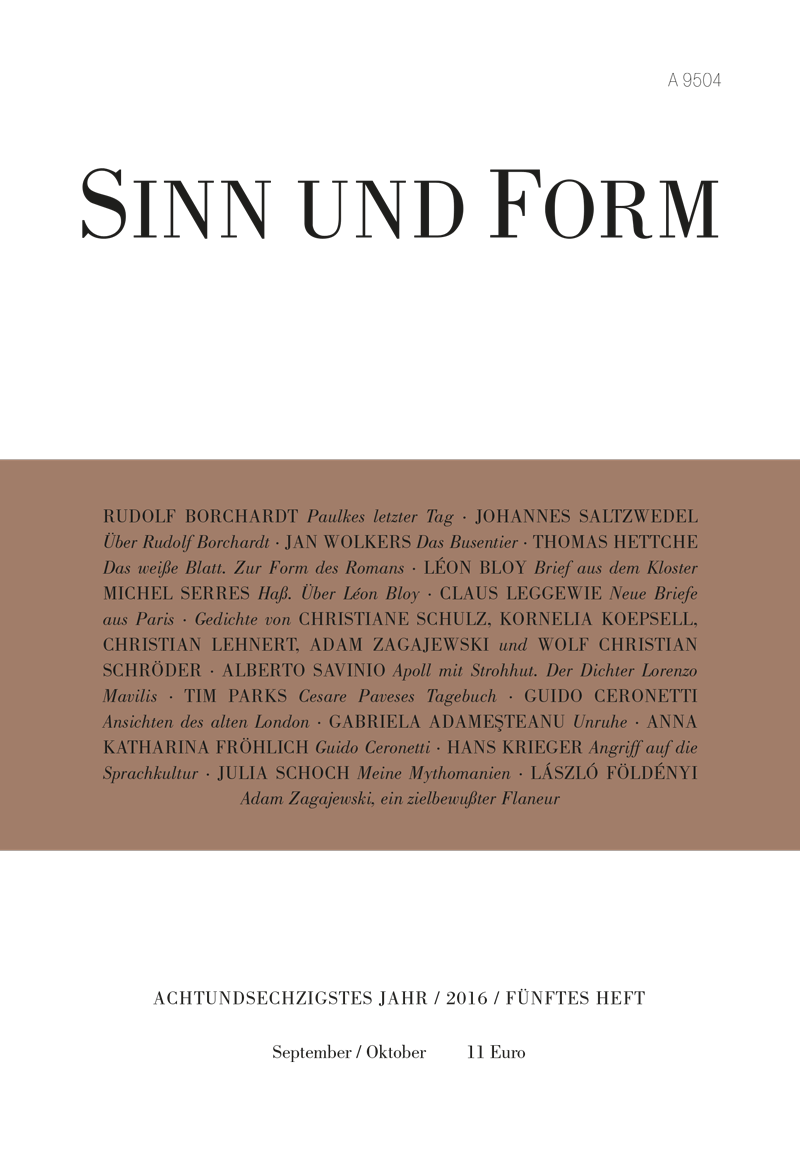Leseprobe aus Heft 5/2016
Krieger, Hans
Angriff auf die Sprachkultur. Zwanzig Jahre Rechtschreibreform
Vor zwanzig Jahren gelang sie am Ende doch: die jahrzehntelang geprobte und immer wieder gescheiterte Umkrempelung der deutschen Orthographie. Mit der »Wiener Absichtserklärung« von 1996 verpflichteten sich die deutschsprachigen Länder sowie Staaten mit relevanten deutschsprachigen Minderheiten zur Einführung einer reformierten Rechtschreibung; noch im gleichen Jahr wurde mit ihrer Einübung in den deutschen Schulen begonnen. Heftige Proteste, vor allem namhafter Schriftsteller, blieben wirkungslos. Vor zehn Jahren dann, 2006, sorgte der von den Kultusministern installierte »Rat für deutsche Rechtschreibung « mit einer halbherzigen »Reform der Reform« für das, was in der offiziellen Sprachregelung »Rechtschreibfrieden« heißt und vom »Deutschlandfunk« unlängst als »Waffenstillstand im Wörterkrieg« bezeichnet wurde. Seitdem herrschen Verunsicherung und die Gleichgültigkeit resignierter Gewöhnung ans Verwirrende, gnädig verdeckt durch die Korrekturprogramme des Computers. Die langfristigen Folgen aber für die Sprachkultur können denjenigen nicht gleichgültig sein, für die der Nuancenreichtum und die Präzision des schriftlichen Ausdrucks von existentieller Bedeutung ist, den Literaten also und allen an Literatur Interessierten. Denn die Rechtschreibreform war ein Angriff auf den Wörterbestand des Deutschen und auf die Wurzeln dessen, was man Sprachgefühl nennt, also das intuitive Verständnis für die Tiefenstrukturen der Sprache.
Die Reformer, nach so vielen vergeblichen Anläufen offenbar nur noch darauf bedacht, überhaupt irgend etwas zu verändern, haben ja nicht nur aus dem »daß« ein »dass« und aus der »Brennessel« eine »Brennnessel« gemacht und dem Leserauge so wundersame Stolperfallen wie »Essstörung«, »Missstand« oder »Flussschleife« gestellt. Sie haben Hunderte von vertrauten Wortzusammensetzungen ("Univerbierungen« nennt sie der Linguist) aus dem Wortschatz gestrichen. Wörter wie »kennenlernen«, »spazierengehen« oder »radfahren«, wie »hochbegabt« oder »weitreichend«, »furchterregend« oder »vielversprechend«, ja sogar »wiedersehen« durfte es nicht mehr geben; aus der Zoologie verschwand das »blutsaugende Insekt« und aus der Botanik die »fleischfressende Pflanze«. Damit waren, anders als beim »keiser im bot«, der sich nicht durchsetzen ließ, nicht nur Schreibweisen verändert; die Substanz der Sprache war angetastet. Bedeutungsunterscheidungen gingen verloren ("wohl bekannt« ist semantisch nicht das gleiche wie »wohlbekannt«); Wortbildungsprozesse, zu denen es ja nicht ohne sinnvollen Grund gekommen war, wurden rückgängig gemacht, und vor allem wurde die Neubildung von Univerbierungen abgeblockt, die ja gerade im Deutschen eine Hauptquelle kreativer Weiterentwicklung ist.
Gewiß: Mit der sogenannten Reform der Reform von 2006 wurde ein großer Teil der verpönten Univerbierungen rehabilitiert. Aber als bloße Varianten, über deren Gebrauch oder Nichtgebrauch nicht das Bedeutungsverständnis, sondern pures Belieben entscheidet. Dies entspricht exakt einem Grundprinzip der Reformer, auf das sie ganz besonders stolz waren: Das Verständnis von Bedeutungsfeinheiten sollte für die Rechtschreibung keine Rolle mehr spielen, weil es als Privileg der »Gebildeten « galt; es sollte überflüssig werden durch leicht zu befolgende simple Regeln, damit Orthographie nicht mehr »Herrschaftsinstrument « zur »Diskriminierung« der »Ungebildeten « ist.
Das wäre selbst dann absurd, wenn es die jedem verständlichen simplen Regeln geben könnte. Sinn und Zweck einer geregelten Orthographie ist ja nicht ihre leichte Erlernbarkeit, sondern das mißverständnisfreie Lesen auch komplizierter Texte und das Ermöglichen einer hochdifferenzierten Sprachkultur, von der auch jene indirekt profitieren, die nicht an ihr teilhaben. Denn in dieser Sprachkultur schult sich die Präzision des Denkens, ohne die es auch die wissenschaftsgestützte Technik mit all ihren Errungenschaften der Lebensbequemlichkeit nicht geben könnte. Aber so simple Regeln, die jedes Sprachgefühl unnötig machen, läßt die Sprache nicht zu, und das stellte sich schnell heraus. »Hochbegabt« sollte getrennt geschrieben werden, weil es sich steigern läßt ("höher begabt«), »blutsaugend «, weil durch die Univerbierung, anders als beim »blutstillenden Medikament«, kein Wort eingespart wird (das Medikament stillt das Blut, das Insekt saugt Blut, ohne Artikel). Für solche Spitzfindigkeiten mußte man fast Sprachwissenschaft studiert haben; selbst Deutschlehrer am Gymnasium sahen sich überfordert, und so wurden die ausgetüftelten Regeln rasch, aber stillschweigend wieder fallengelassen. Schon der zweite Reform-Duden ließ für »blutsaugend« wie »blutstillend« Getrennt- wie Zusammenschreibung unterschiedslos zu. Aus der abstrusen Mixtur aus Rigidität und Willkür war pure Beliebigkeit geworden. Die Ausschaltung des Sprachgefühls aber blieb.
Dafür sorgte auch die »Reform der Reform« von 2006. Sie wurde durchgesetzt, obwohl der Rat für deutsche Rechtschreibung das dornige Kapitel der Groß- oder Kleinschreibung noch gar nicht behandelt hatte. Den Kultusministern pressierte es, sie wollten endlich den »Rechtschreibfrieden«. Und der Ratsvorsitzende Hans Zehetmair beugte sich. Er, als bayerischer Kultusminister einst eifrigster Reformbetreiber, am Ende seiner Amtszeit aber zu der Einsicht gelangt, daß der Staat in die Entwicklung der Sprache nicht eingreifen dürfe, hatte nicht noch einmal den Mut, den er im Spätjahr 1995 bewiesen hatte. Damals hatte er, im Vorfeld der Wiener Vereinbarungen, auf Nachbesserungen am Reformkonzept bestanden und auf die Frage von Spiegel-Reportern, ob er es denn verantworten könne, daß wegen seiner Forderungen eine fertige Auflage des »Duden« eingestampft werden müsse, ungerührt zur Antwort gegeben: »Da haben sich die Herren halt verspekuliert.«
Die Folge: Schreibungen, die gegen die Logik der Sprache verstoßen, wie »heute Morgen«, »seit Langem«, »bei Weitem«, »im Übrigen«, bleiben dauerhaft vorgeschrieben. Hier also wurde festgehalten an der Simplizität der Regel: was irgendwie nach einem Substantiv aussieht, muß groß geschrieben werden. Auch wenn es für das Sprachgefühl und erst recht bei logischer Analyse seinen substantivischen Charakter längst verloren und eine adverbiale Funktion übernommen hat, fast immer auch mit einem schlichten Adverb umstandslos austauschbar ist: »seit Langem« mit »längst«, »im Übrigen« mit »übrigens« oder »außerdem «. Anders als bei vielen Fällen der Getrennt- oder Zusammenschreibung steht hier keine Variante wahlweise zur Verfügung. Wer korrekt schreiben will, muß sein Sprachgewissen vergewaltigen.
Die zahllosen Univerbierungen der herkömmlichen Rechtschreibung sind nie von Ministerien beschlossen und von Verwaltungsorganen durchgesetzt worden. Sie fanden Verbreitung, weil sie sich als zweckmäßig und sinnvoll bewährten und einem Bedürfnis nach Präzision des Ausdrucks entsprachen. Es ist schon sehr die Frage, ob Parlamente befugt wären, die Sprachentwicklung gesetzgeberisch umzulenken. Die Rechtschreibreform von 1996 aber wurde unter Umgehung des Gesetzgebers bloß auf dem Verordnungsweg durchgedrückt; treibende Kraft war die Kultusministerkonferenz, die kein Verfassungsorgan ist, ein »rechtliches Nullum« (Staatsrechtler Rupert Scholz), das lediglich Empfehlungen abgeben kann. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Vorgehensweise mit der seltsamen Begründung gutgeheißen, von einem »wesentlichen« Eingriff, der dem Gesetzgeber vorbehalten bleibt, könne nicht die Rede sein, da nur ein kleiner Bruchteil des gesamten Wörterbestandes von der Reform betroffen sei. Welch absurde Verwechslung von Qualität und Quantität! Als ob jemand, der durch Körperverletzung einen Finger eingebüßt hat, nicht »wesentlich« beeinträchtigt wäre, weil er ja weniger als ein Promille seiner Körpersubstanz verloren hat. Noch hanebüchener war die zweite Begründung, daß die Reformschreibung ja nur für Schule und Amtsgebrauch verbindlich sei und ansonsten jeder schreiben könne, wie er wolle. Als ob es rechtens sein könnte, von Schulkindern das Erlernen einer Rechtschreibung zu verlangen, die nicht die allgemein übliche ist, sondern nur in Schulen und Ämtern gilt.
Das Urteil fiel im Juli 1998. Was damals zur Debatte stand, gibt es längst nicht mehr, hat es im Grunde nie wirklich gegeben. Die Rechtschreibreform war von Anfang an ein Verwirrspiel voller Unklarheiten und Widersprüche und wurde von Duden-Auflage zu Duden-Auflage sukzessiv aufgeweicht und modifiziert. Von einer in sich kohärenten, verbindlich kodifizierten Reformschreibung kann keine Rede sein. Entsprechend chaotisch sieht die Schreibpraxis aus; in Zeitungen und Büchern findet man immer wieder die abenteuerlichsten Getrenntschreibungen. Einigermaßen gesichert ist nur die neue ss-Schreibung ("dass« statt »daß«); sie hat allerdings in den Schulen nicht zu weniger, sondern zu mehr Fehlern geführt, wie etliche Studien belegen. Mancher sieht in dieser Chaotisierung sogar einen Fortschritt: endlich sei die Überbewertung der Rechtschreibung überwunden. Das hätte man freilich einfacher haben können: Beibehaltung des alles in allem Bewährten mit einer Zusatzregel, die alle schwer zu entscheidenden Zweifelsfälle dem Sprachgefühl und Stilwillen des Schreibenden anheimgibt. Ein großer Irrtum aber wäre es zu glauben, die Beliebigkeit sei ein Freiheitsgewinn. Nur wo es klare Regeln gibt, kann die bewußte Abweichung als Akt der Freiheit wirken und dem Ausdruckswillen oder der stilistischen Profilierung dienen. An der Beliebigkeit erstickt die Freiheit. Goethe wußte es: »Das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.« Vorausgesetzt, das Gesetz ist vernunftgemäß. So vernunftgemäß, wie es die deutsche Rechtschreibung bis 1996 war.
SINN UND FORM 5/2016, S. 705-707