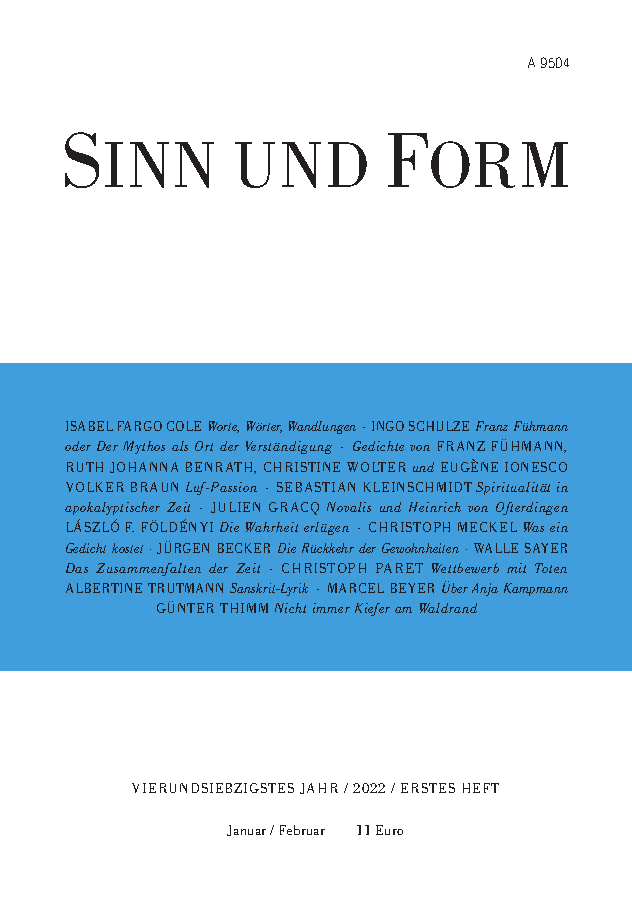
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-63-8
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 1/2022
Schulze, Ingo
»Ich möchte Ihnen Hoffnung machen«.
Franz Fühmann oder Der Mythos als Ort der Verständigung
Anfang Juli 1984 wartete ich in der Sektion Altertumswissenschaften der Uni Jena darauf, zu meiner ersten mündlichen Prüfung (Grundkurs Griechenland) aufgerufen zu werden. Der Dozent, der schließlich die Tür öffnete und mich hereinbat, sagte, während ich aufstand und auf ihn zuging: »Ach, wissen Sie schon? Gestern ist Fühmann gestorben!«
In diesem Augenblick brach für mich eine Welt zusammen. Ich hatte Franz Fühmann nie persönlich erlebt, war nie auf einer Lesung von ihm gewesen, ich hatte ihm nie geschrieben, ich hatte weder Fernsehbilder von ihm gesehen noch wußte ich, wie seine Stimme klang. Ich kannte nur einige seiner Bücher. Trotzdem lebte ich in der Gewißheit, in ihm einen wohlwollenden Leser zu haben, sobald ich nur etwas Selbstgeschriebenes vorzuweisen hätte. Ich würde nicht leichtfertig sein, denn in unserem Land, so schien mir, gab es kaum jemanden, der nicht schrieb und seine Texte nicht Fühmann schicken wollte. Auch mir war er die Versicherung dafür, nicht unbeachtet zu bleiben, sollte meine Schreiberei etwas taugen. Ich weiß nicht, woher ich damals diese Gewißheiten nahm. 1984 hatte ich von ihm gerade die im Jahr zuvor erschienenen Essays gelesen. Lag es an seinem Text über Wolfgang Hilbig? Da schenkt Fühmann seinem Verlag einen Schriftsteller. Und welcher unveröffentlichte Autor träumte nicht davon? Oder lag es an seiner Vorlesung »Das mythische Element in der Literatur« oder den E. T. A.- Hoffmann-Essays? Und noch während meines Grundwehrdiensts hatte ich »Vor Feuerschlünden«, seinen großen Trakl-Essay, gelesen, der den Schattenriß einer Autobiographie in sich barg. Dessen Offenheit, das Vorweisen der eigenen grauenhaften Irrtümer, war bestürzend und befreiend. Nicht weniger unerhört war Fühmanns Reflexion darüber, daß er selbst nach Salzburg fahren durfte, während anderen diese Möglichkeit verwehrt wurde. Wer von denen, die fahren durften, sprach sonst darüber? Wenige Wochen vor jener ersten Prüfung hatte ich einen Vortrag halten dürfen, ein Vergleich von Christa Wolfs »Kassandra« mit Fühmanns »König Ödipus«, es ging um die verschiedenen Arten des Umgangs mit dem Mythos. Daher wußte der Dozent, daß mich dieser Autor etwas anging. Doch 1984 gab es für den einundzwanzigjährigen Studenten kaum Bücher, die ihn nicht ergriffen, veränderten, erhoben, quälten oder zum Epigonen machten. Beinah jedes Zeugnis von Geistigkeit konnte brisant werden, jede Lektüre, jedes Gespräch fand in einem Alltag statt, den politisiert zu nennen sich erübrigte. Alles war politisch. Einen anderen Alltag kannte ich nicht. Doch warum ausgerechnet Franz Fühmann? Der Sternenhimmel der ostdeutschen Literatur leuchtete schließlich hell.
Als Kind habe ich nicht gelesen, drängte aber darauf, vorgelesen zu bekommen. Relativ früh bekam ich »Das hölzerne Pferd – Die Sage vom Untergang Trojas und von den Irrfahrten des Odysseus. Nach Homer und anderen Quellen neu erzählt von Franz Fühmann« geschenkt. Bei Fühmann sind die Götter keine erhabenen Wesen, aber mächtig und gefährlich. »Poseidon hat in meiner Vorstellung oft Züge eines Bahnhofvorstehers«, schreibt er 1973. »Den Apollo könnt’ ich mir ganz gut so denken, den Hermes und Ares zur Not, den Hephaistos, Hades, Dionysos gar nicht. Auch Zeus nicht, ihn am wenigsten: Dies Amt wäre für ihn zu groß / Den Prometheus auch nicht, der spielte herum … Aber Epimetheus wäre die ideale Besetzung.« Wenn meine Langeweile zu groß wurde, nahm ich mir das Buch heraus und blätterte zu jener Stelle – ich erkannte sie an den Illustrationen –, an der die Trojaner die Griechen fast zu besiegen scheinen. Weil es in dieser Neuerzählung soziale und ökonomische Unterschiede gibt, gewinnt eine Figur wie Thersites an Bedeutung. Er, der einzige ohne Genealogie und Adelsrang, der Mann aus dem Volk, der »immer zum Friedensschluß und zur Rückkehr in die Heimat geraten« hat, erzählt bei Fühmann von Prometheus, denn »die Götter sind grausam und böse und den Menschen feind«. Doch Fühmann weiß: »Im Mythos ist immer der ganze Mensch da, auch als Geschlechts-, auch als Naturwesen, aber nie auf diese reduziert.«
Auf Troja und Odysseus folgte beim abendlichen Vorlesen bald das Kinderbuch »Prometheus«. In ihm entdeckt Fühmann eine Figur, die Aufstieg und Fall verschiedener Zeitalter verbindet. Der Menschenfreund Prometheus wird zum Protagonisten eines Machtkampfs, der den jungen Lesern oder Zuhörern ein Gefühl für das Gewordensein der Welt gibt, für die Abfolge von Bündnissen und Kämpfen, aus denen Hierarchien und damit Herrschaftsverhältnisse entstehen. Erwachsenen mußte es schon damals (und heute erst recht aufgrund der postum erschienenen Teile) als Parabel auf das 20. Jahrhundert erscheinen. Das gilt auch für die »Nibelungen« und erst recht für »Reineke Fuchs«, der im Grunde bereits ein Muster für alle Mafia-Serien liefert: Der Schurke ist tatsächlich ein Schurke, aber als Leser hält man ihm unfaßbarerweise die Treue.
Fühmanns Neuerzählungen von Mythen und Sagen beunruhigten mich als Kind. Warum findet Hektor solch ein schmähliches Ende? Warum muß Prometheus so schrecklich leiden und gewinnt nicht gegen Zeus? Warum sind Götter eitel und egoistisch? Das waren nicht jene Figuren, die ich später im Museum fand. In einer Gegenwart, in der alles überdeutlich in Gut und Böse aufgeteilt war, stifteten Fühmanns Neuerzählungen Verunsicherung. Man wußte ja nicht einmal, wer die Guten und wer die Bösen waren. Diese Verunsicherung war für mich (und nicht nur für mich) noch wichtiger als die lustvolle Vermittlung weltliterarischer Stoffe, über die wir in der Schule (mit Ausnahme des »Reineke Fuchs«) kaum etwas hörten. Im Schullesebuch der 8. Klasse begegnete ich Fühmann mit »Kabelkran und blauer Peter«. Ich war irritiert, vielleicht sogar etwas enttäuscht, daß »mein« Autor, der doch bisher ganz der häuslich-vertrauten Atmosphäre angehört hatte, nun »allen« gehörte und Götter und sprechende Tiere keine Rolle spielten. Ich kann mich nicht mehr an die Lesestellen erinnern. Sie werden den Vierzehnjährigen nicht vom Hocker gerissen haben.
Wer heute in Bitterfeld an dem großen, gerade einmal wieder vor dem Abriß geretteten Kulturhaus vorüberfährt, in dem einmal herausragende nationale und internationale Ensembles und Solisten auftraten, in dem die Arbeitenden und ihre Kinder sich in Ballett und Fotografie, in bildender Kunst und Schauspiel versuchen konnten, dem bleibt der Spott über den »Bitterfelder Weg« im Hals stecken, auch wenn dieser in mehrfacher Weise ein Irrweg war. Denn was tatsächlich für »Bitterfeld« tauglich gewesen wäre, wie zum Beispiel der grandiose Roman »Erziehung eines Helden« von Siegfried Pitschmann, dem zweiten Ehemann von Brigitte Reimann, der aus freien Stücken und vor dem Bitterfelder Beschluß auf den Baustellen von Hoyerswerda / Schwarze Pumpe geschuftet hatte, wurde nicht nur nicht gedruckt. Der Autor wurde durch absurde Kampagnen gedemütigt und zum Selbstmordversuch getrieben.
Fühmann hat sich dem Anspruch des »Bitterfeldes Wegs« gestellt und immer wieder versucht, ihn zu erfüllen. Doch sein Widerspruch ist grundsätzlicher Art: »Was zum Beispiel empfindet ein Mensch, der weiß, daß er sein Leben lang so ziemlich dieselbe Arbeit für so ziemlich dasselbe Geld verrichten wird, als beglückend und was als bedrückend an eben dieser Arbeit; wo bringt sie ihm Reize, wo Freude, wo Leid, in welchen Bildern, auf welche Weise erscheint sie in seinem Denken und Fühlen usw. usw. Ich weiß es nicht und kann es nicht nachempfinden, und der Arbeiter spricht, obwohl er mein Freund ist, nicht darüber, weil es für ihn die allerselbstverständlichsten Dinge sind, so selbstverständlich, daß man die Frage danach gar nicht versteht, weil man die Antwort eben in Fleisch und Blut hat, nicht im Mund.«
Fühmann schummelt nicht. Es ist der Blick von einem, der die Welt der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht aus eigener Erfahrung kennt, sich das aber als Defizit ankreidet und sich damit nicht abfinden will.
»Aufs Gymnasium kamen Arbeiter nicht; nach dem Abitur war ich zur Wehrmacht gekommen und hatte ein Maschinengewehr bedienen gelernt; in sowjetischer Kriegsgefangenschaft hatte ich in einem kleinen Waldlager Bäume gefällt und dann Karl Marx gelesen, und nach meiner Entlassung war ich für zehn Jahre an einen Büroschreibtisch geraten«, wo er seine Zeit »mit der Gliederung von Lektionen und Referaten, mit Aktennotizen und einem Rattenkönig an Papier und Protokollen hingebracht« hat. Hier macht sich einer auf den Weg, der nur den »Abklatsch der Wirklichkeit auf Rotations- und Schreibmaschinenpapier« kennt.
Fühmann, für den »Wahrheit und Schreiben« Synonyme sind, markiert eher die Unterschiede, die ihn von den Arbeitern trennen, als daß er die Grenzen mit seiner erzählerischen Kraft verwischt. Weil er die Voraussetzungen seines Schreibens benennt, weil sein Blickwinkel nichts vortäuscht, weiß ich als Leser immer, woran ich bei ihm bin.
Deshalb ist »Kabelkran und blauer Peter« heute wohl noch interessanter als bei seiner Veröffentlichung 1961. Denn diejenigen, deren Arbeit körperliche Schufterei ist, werden heute in der Literatur, im Film und Fernsehen kaum noch sichtbar – und wenn, dann als underdogs in den Nachmittagsprogrammen. Diese Exkursion des Schriftstellers auf die Werft (er hat viele weitere Versuche unternommen, in Großbetrieben zu arbeiten) liest sich von heute aus auch als Beginn eines Weges, der zu seiner literarischen Schürfarbeit »Im Berg« führen wird. Seine Erzählungen entdeckte ich nicht selbst. Anfang 1978, in den Winter ferien der 9. Klasse, saß ich der Malerin Gerda Lepke in ihrem winzigen Atelier am Laubegaster Ufer in Dresden Modell. Ich hatte gerade die Hermann-Hesse- Romane und Erzählungen gelesen und rang mit mir, ob ich in den sogenannten persönlichen Gesprächen mit unserem Klassenlehrer, der uns für die Offizierslaufbahn werben oder zumindest das Zugeständnis eines dreijährigen Armeediensts abpressen wollte, nicht doch, wie mein Banknachbar, er war Mitglied im Kreuzchor, bekennen sollte, den Dienst an der Waffe aus religiösen Gründen zu verweigern. Während Gerda mit der schräg vor ihr liegenden Leinwand kämpfte – die Pinsel waren an Stöcke gebunden – und mir von dem Duft der Ölfarben und des Terpentins, dem vielen Kaffee und dem überheizten Raum schon etwas flau war, sprach sie darüber, daß sie sich gerade mit Fühmann »beschäftige«. Sie schien immer einen Autor zu haben, mit dem sie sich beschäftigte. Und darunter waren einige, die ich auch aus meinen Lesebüchern kannte, Kurt Tucholsky und Majakowski zum Beispiel, aber auch ein gewisser Robert Walser, von dem ich noch nie gehört hatte. Nun sprach sie über Fühmanns Erzählungen. Vor allem die erste, »Kameraden«, empfahl sie mir nachdrücklich (die unter dem Titel »Betrogen bis zum jüngsten Tag« verfilmt worden war). Ich kaufte mir den Band (oder bekam ich ihn geschenkt?) und muß zumindest bis zum »König Ödipus« gelangt sein. Etwas später las ich den Zyklus »Das Judenauto«, ohne mir des Glücks bewußt zu sein, ihn in der ursprünglichen Fassung kennenzulernen, die allerdings erst 1979 herausgekommen war, achtzehn Jahre nach der Erstpublikation. Wiederum vier, fünf Jahre später, ich war schon Student, nahm ich mir die Erzählungen wegen des »Ödipus« erneut vor. Erst da fielen mir die Verletzungen auf, die Fühmann seinen Texten aus Überzeugung oder Selbstzensur zugefügt hatte. In »König Ödipus« planen Wehrmachtssoldaten während der Okkupation Griechenlands eine Aufführung der Tragödie des Sophokles. In langen Gesprächen bemühen sie sich um deren Deutung und offenbaren dabei ihren Rassenwahn wie ihre Blindheit für die eigene Situation. Die langen Sätze der Beschreibungen und wörtlichen Reden winden sich wie Schlangen um die Figuren. Immer gehetzter wird der Erzählduktus, der das Geschehen auf die Katastrophe zuführt. Die Peripetie blitzt auf den letzten zwei Seiten wie eine Erkenntnis auf, die nicht gänzlich unvorbereitet kommt, jedoch in der Eindeutigkeit, ja Konformität, mit der sie geschildert wird, die Novelle ihrer Ambivalenz beraubt und einen Hauptmann dem Publikum sagen läßt, was Sache ist: »und nun brach die neue Zeit des Menschenrechts aus den Schlünden des Balkans und den Hainen des Maquis und den sanften Ebenen Polens und rollte donnernd her aus den Weiten Rußlands, um die alte Zeit zu begraben, der anzugehören einfach schon Schuld war«.
Es zerstört nicht die Novelle, aber es bleibt ein Kratzer, den man wie auf einer Schallplatte hört. Das als Fühmanns Tribut für eine Veröffentlichung zu deuten, wäre zu billig. Allein äußeren Zwängen hätte er sich nicht gebeugt. Die vierzehn Erzählungen von »Das Judenauto« fügen sich zu einer großen Lebenserzählung, die man heute wohl »Roman« nennen würde. Dafür, wie Fühmann die eigene Verblendung nachzeichnet, gibt es, soweit ich das sehe, kaum Vergleichbares in deutscher Sprache. Kindheit, Jugend, die Zeit im Arbeitsdienst, in der Wehrmacht und der sowjetischen Gefangenschaft werden aus der Position desjenigen erzählt, der die nationalsozialistische Gesinnung verinnerlicht hat. Dieses »ich«, sei es das Kind mit seiner Angst vor den Juden oder der Landser, der noch Anfang Mai 1945 auf die Wunderwaffe hofft, quält mich als Leser, weil er keinen Ausweg aus seiner Logik findet, einem Gespinst aus Antisemitismus, Nationalismus, Antikommunismus, Herrenmenschentum, Angst und Rechtfertigung von Kriegsverbrechen. Die Unerbittlichkeit vorzuführen, die dieses Denken beherrscht, es nacherlebbar zu machen, wie ein Glauben auch Lüge und Verbrechen zu integrieren vermag, ist die Leistung dieser Prosa. Die zwei letzten Erzählungen fallen heraus und bekennen sich nun, da sich das erzählende Ich dem Abgrund entkommen glaubt, zur im Entstehen begriffenen neuen Welt, deren Licht aus dem Osten kommt. Dabei bleibt Fühmanns Darstellung so anschaulich und deutlich, daß ich als Leser die alten Muster unter dem neuen Bekenntnis sehe. Nun sollen sie aber wirklich einer anderen, einer besseren Sache dienen. In den Nachbemerkungen zur Ausgabe von 1979 schreibt Fühmann: »Diese vierzehn Episoden des ›Judenautos‹ werden hier dem Leser zum ersten Mal in der ursprünglichen Gestalt des Gesamtzyklus mitgeteilt. Die bisher gedruckte Version folgte dem Redigierungsvorschlag meiner damaligen Lektoren, die jene erste Fassung für unlesbar hielten. Heute scheint es mir eher umgekehrt, aber es ist meinen Autoritäten von damals gelungen, mich zu überzeugen, und ich füge hinzu: Sie hatten’s nicht schwer.« Fühmann spricht von einem literarischen Qualitätsgefälle »zwischen der ersten und der letzten Geschichte«, wobei die Vorschläge der Lektoren »auf eine Angleichung« hinausliefen, »wenn auch auf eine nach unten«.
Sein Zusatz »Sie hatten’s nicht schwer« ist etwas, worauf man immer wieder bei Fühmann trifft. Er schiebt das Versagen nicht auf andere, auf die Zensur. Seine inneren Nöte und Schuldgefühle, auch seine Hilflosigkeit, gehören dazu. »Ich widerstehe jedoch auch heute der Versuchung«, fährt Fühmann fort, »diesen Zyklus, dessen methodischer Eklektizismus mir bald weh tat, zu verstümmeln oder umzuarbeiten, also eine erste ästhetische Reflexion über den Ort meiner selbst in der neuen Gesellschaft auf den Stand einer zweiten und dritten zu bringen, anstatt eben diese zweite und dritte als bewußteres Leben und Schreiben zu leisten und die erste zu lassen, was sie gewesen ist: Stufe. Im Prozeß der Selbstfindung eines Autors sind alte Arbeiten nur korrigierbar durch neue, vorausgesetzt, daß sie das überhaupt sind (…).« Nach einem Hinweis auf Brecht heißt es dann: »Das Endziel meiner literarischen Bemühungen wäre die Darstellung Eines, von dem ich erfahren könnte, dieser sei ich. Ich werde sie wohl nie in dem Grade vollbringen, in dem ich ihr Vollbringen wünsche wie fürchte: Nicht der äußere Zensor, der innere ist das Hauptproblem. Nebenbei: Die Identität dieser Instanzen (…) macht letztlich den Mangel des ›Judenautos‹ aus.«
Das Bestehen einer Zensur in der DDR öffentlich anzusprechen ist das eine, den eigenen Anteil daran zu benennen das andere. Fühmann legt den Zusammenhang beider Zensuren offen. Für ihn ist Veränderung ein gesellschaftlicher und ein persönlicher Prozeß, also etwas, das sich gegenseitig beeinflußt und in Bewegung ist. Für die Selbstermächtigung und Emanzipation, die Fühmann im Laufe seines Lebens gelingt – bei allen Skrupeln, die an ihm in verschiedenste, mitunter entgegengesetzte Richtungen zerren –, brauchen Staat und Gesellschaft letztlich bis zum Herbst 1989, auch wenn sich der Spielraum zuvor stetig erweitert hat.
[...]
SINN UND FORM 1/2022, S. 20-31, hier S. 20-25
