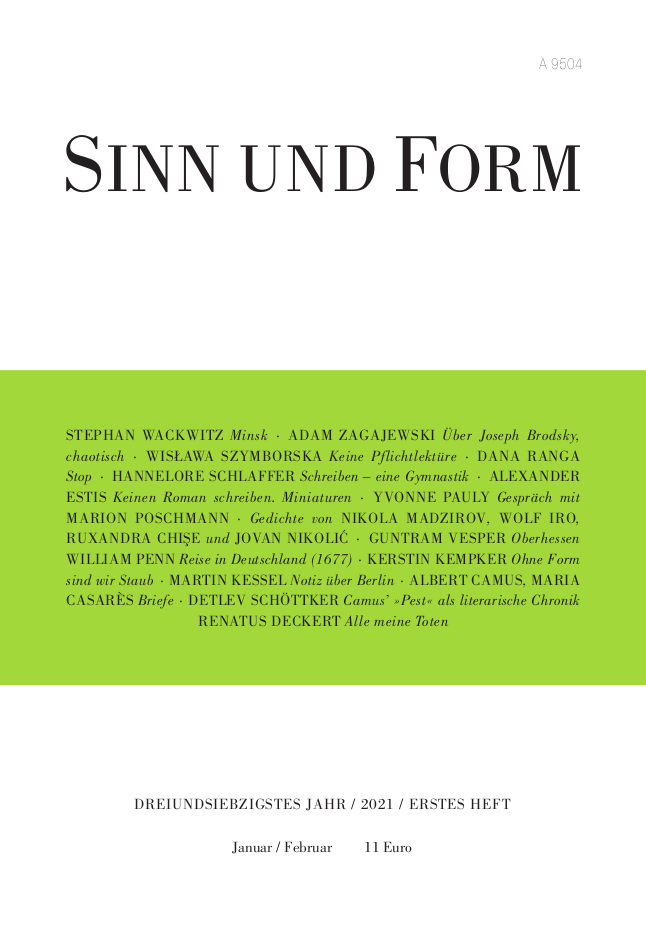
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-57-7
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 1/2021
Wackwitz, Stephan
Minsk. Widersprüche der Utopie
Wer ehemalige Sowjetrepubliken, die jetzt ihren eigenen politischen Weg gehen, besucht oder für einige Zeit dort lebt, denkt unwillkürlich darüber nach, wie jene Städte, Landschaften, Atmosphären und Mentalitäten heute aussähen, wenn sich die kommunistische Union 1991 nicht aufgelöst hätte. Hätte das sozialistische Staatswesen, das noch vor dreißig Jahren eine globale Supermacht war, möglicherweise eine Chance gehabt, in veränderter Gestalt weiterzubestehen? Hätte es sich der Weltwirtschaft und den Einflüssen der konsumistischen Kultur vorsichtig öffnen, seinen Bürgern ein im privaten Rahmen selbstbestimmtes Leben ermöglichen, den quasireligiösen Geltungsanspruch des Marxismus-Leninismus sublimierend auflösen und so auf einem »Dritten Weg« zwischen Kapitalismus und Kommunismus in die Zukunft reisen können? Vergleichbare Vorstellungen waren in der linken Intelligenzija weit verbreitet, als in Deutschland über die Zukunft der gescheiterten DDR nachgedacht (phantasiert) wurde. Die Wirklichkeit ist andere Wege gegangen. Aber tatsächlich gibt es östlich von Polen eine ehemalige Sowjetrepublik, die seit 1990 einen Weg zwischen völliger Aufgabe der realsozialistischen Verhältnisse und bedingungsloser Integration in die kapitalistische Weltgesellschaft versucht hat – bis nach den gefälschten Wahlen im letzten August der Widerspruch zwischen der wirtschaftlich erfolgreichen jungen Mittelschicht und dem despotischen Regierungsapparat revolutionär explodierte. Diese Republik, in der sich inzwischen eine Doppelherrschaft zwischen Volksaufstand und staatlicher Gewalttätigkeit entwickelt hat, war vierzig Jahre lang nicht ohne Grund der unbekannteste Staat Europas.
Belarus war eigentlich immer unbekannt. Fast seine gesamte Geschichte hindurch hatte dieses Land weder Grenzen noch eine Armee oder eine eigene Regierung. Es galt eher als (relativ unbestimmte) Ortsbezeichnung, als Landschaft, als geographischer Begriff. Erst 1918, nach dem Zusammenbruch des Zarenreichs, ist von einem Staat dieses Namens die Rede. Aber die Unabhängigkeit währte nur einige Monate, dann wurde Belarus der Sowjetunion eingegliedert. Auch zuvor war das Staatsgebiet der heutigen Republik immer Teil anderer politischer Gebilde gewesen. Zuerst gehörten seine Städte und Landstriche zur Kiewer Rus. Nach der tatarischen Eroberung Kiews 1240 bürgerte sich die Bezeichnung »Belarus« für die westlichen, den Mongolenkhanen nicht tributpflichtigen russischen Fürstentümer ein. Im Spätmittelalter und während der frühen Neuzeit waren sie Bestandteil des polnisch-litauischen Doppelstaats. Nach der zweiten polnischen Teilung kam das spätere Belarus zum Zarenreich, nach der erwähnten kurzen und erfolglosen Eigenstaatlichkeit dann als Republik zur UdSSR – erst damit hatten sich die fließenden Grenzen dieses halb geträumten Landes einigermaßen verfestigt. Das heutige, postsowjetische Belarus ist nach 1990 dadurch entstanden, daß die führenden Kader des weitgehend unveränderten belarussischen Staatsapparats die Macht an nicht mehr (oder nicht mehr explizit) kommunistische Politiker abgaben – welche freilich zum größten Teil (wie der heutige Staatspräsident Lukaschenka) zuvor durchaus loyale Kommunisten gewesen waren. Im ährenumkränzten Staatswappen der einstigen Sowjetrepublik wurden Hammer und Sichel durch eine Silhouette des Landes ersetzt. Die heraldisch unvermeidliche Sonne geht jetzt hinter den Landesgrenzen auf, nicht mehr hinter dem Symbol der proletarischen Internationale. Der zentrale Leninboulevard in der belarussischen Hauptstadt Minsk wurde umbenannt und feiert inzwischen die Unabhängigkeit. So gut wie alle anderen wichtigen Straßen – wo sich heute avantgardistisch eingerichtete Restaurants und Bars aneinanderreihen, elegante Frauen und bärtige Hipster flanieren – heißen jedoch weiterhin nach den Klassikern der marxistisch-leninistischen Theorie, nach sowjetischen Partisanenführerinnen und kommunistischen Politikern wie Kirow, Swerdlow, Dscherschinski und Kalinin. Der überwiegende Teil der belarussischen Wirtschaft befindet sich immer noch in Staatseigentum und wird nach wie vor durch Fünfjahrespläne gesteuert.
Ich bin im tiefen Winter zum ersten Mal nach Minsk gekommen, im Januar 2015. Schon Tage zuvor war ich voll düsterer Vorahnungen und Befürchtungen. Um ehrlich zu sein: Ich hatte Angst vor meiner Reise nach Belarus. Es war spät in der Nacht bei meiner Ankunft und ich lief in dem weitgehend menschenleeren, blitzsauberen und bis in den letzten Winkel neonhell ausgeleuchteten Minsker Flughafen todmüde von Pontius zu Pilatus, um Geld zu wechseln und bei einer schlechtgelaunten Schalterbeamtin für Pfennigbeträge eine Krankenversicherung abzuschließen. Dann wurde mein Visum von einer Zollbeamtin in ihrem Glaskabuff am Ausgang ins Land minutenlang – unter anderem mit einer Lupe – geprüft. Daß sich das Schloß meines schicken neuen Aluminiumkoffers, der am längst ruhenden Gepäckförderband vereinsamt im Neonglast stand, als kaputt erwies, arbeitete ich sofort zu einer politischen Gruselgeschichte um: der KGB (wie der belarussische Geheimdienst heute noch heißt) habe ihn geöffnet und nach ideologischer Konterbande durchsucht. Als ich vier Wochen später den reparierten Koffer bei der Ankunft in München in genau demselben Zustand vom Förderband zerrte, verstand ich, daß das nicht versenkte Bügelschloß des guten Stücks eine flugreisenuntaugliche Fehlkonstruktion war. Bis dahin war ich überzeugt, ins Fadenkreuz finsterer politischer Mächte geraten zu sein.
Es folgte die Fahrt durch das nächtliche Minsk. Und damit meine erste, noch flüchtige Bezauberung durch die Architekturen dieser Stadt. Der erste coup de foudre von vielen, die noch folgen sollten. Denn selbst dem verängstigten, wütenden und übernächtigten Reisenden mußte auffallen, daß die von unzähligen Scheinwerfern angestrahlte Folge historistischer Paläste, die sich theaterkulissenhaft in immer phantasmagorischerer Prächtigkeit zu beiden Seiten des champs-élysées-breiten Zentralboulevards entfaltete, geradezu bestürzend schön war. Obwohl sich die sanften Hügel der flachen belarussischen Landschaft bis in die Innenstadt fortsetzen, waren die Traufhöhen der champagnerfarbenen, von weißen Portikos, Säulen, Pilastern und Freitreppen gegliederten Ministerien, Wohnpaläste, Universitätsgebäude, Fabriken und Museen so genau aufeinander abgestimmt, daß sich ein geschmeidehaft einheitlicher Eindruck ergab – Resultat einer (wie ich später erfuhr) ausgeklügelten staatlichen Planungsästhetik, die in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren keine Straßenecke, keine Dachform, keine Fensteranordnung unbedacht gelassen hat. Es war ein gelungenes Paradox: Höchst individuell durchgestaltete Baukörper (deren formale Matrizes der italienischen Renaissance und dem russischen Klassizismus entstammten) ergaben ein schlagend prägnantes Gesamtbild. Angeleuchtete Balustraden hoben sich auf neobarocken Fassaden gegen den Nachthimmel ab. Unter dem Straßenniveau gelegene Parks taten sich hinter Begrenzungsmauern auf, wo in regelmäßigen Abständen eisschrankgroße Vasen und Urnen standen. Der Wagen überquerte eine von gußeisernen Geländern eingerahmte Brücke. Man sah auf eine weite nachtschwarze Wasserfläche hinab, deren geschwungene Ufer von einem weiß schimmernden Monopteros bewacht wurden. Zwischen mannshohen Marmorkugeln führten breite Treppen von dunklen Parkbäumen zu dem seebreit aufgestauten Fluß. Hinter durchsichtigen Winterwipfeln standen auf einem Hügel die Säulen eines neoklassizistischen Schlosses im Scheinwerferlicht: das Dienstgebäude der Generalität der belarussischen Sowjetrepublik, wie ich am folgenden Tag im Reiseführer las. Ein neogotisch aufstrebender Turm rechts davon trug den Sowjetstern.
In der barocken Altstadt war die Straße hügelaufwärts durch einen Schlagbaum gesperrt. Hier begann die Fußgängerzone. Ich schleppte meinen kaputten Koffer durch den tiefen Schnee zu meiner Herberge. Der Hotelkomplex Monastyrski ist ein umgebautes Barockkloster, breit hingelagert auf halber Höhe des Altstadthügels. Weiße Kirchen – zwei katholische in der flamboyanten Formenüberfülltheit des osteuropäischen Barock und der goldstrahlende Türmchenwald eines orthodoxen Gotteshauses – sehen in einen Innenhof von der Größe eines halben Fußballfeldes, über dem sich dreistöckig die geräumigen ehemaligen Mönchszellen türmen. Eine würde jetzt ein paar Tage lang mein Zimmer sein. Ein schweres Eichenbett. Ein ausladender dunkler Schrank. Die runden, irgendwie jagdschloßartigen Leuchter, die in den langen, nächtlich leeren Gängen unter den Korbgewölben hingen. Einerseits hatte das Klostergebäude, besonders von außen, etwas Tibetisches (ein frühbarockes Shangri-La). Andererseits schien mir, wenn ich durch diese Korridore zum Frühstücksraum und wieder zurück zu meinem Zimmer wanderte (und mich dabei mehr als einmal verirrte), ich sei in den Schauplatz eines noch nicht gedrehten Films von Wes Anderson geraten.
Zurück in meinem Dienstort in Georgien verblaßte die Erinnerung an Minsk wieder. Mir blieben die Bilder fröstelnder Wanderungen durch Nebel und Schnee zwischen den Palästen des Unabhängigkeitsboulevards, des heruntergekommenen, ehemals altdamenhaft gediegenen Interieurs im Restaurant Oliva, ein Selbstporträt Jurij Pens vom Anfang des letzten Jahrhunderts (es zeigt den Zeichenlehrer Marc Chagalls und El Lissitzkys in einer atelierartigen Witebsker Mansarde, wo er Pellkartoffeln frühstückt) oder die Erinnerung an die kosmischen Phantasien des dämonisch genialen Spinners und Malers Jasep Drasdowitsch, der in den zwanziger Jahren das Leben der Marsmenschen malte – unvergeßlich, weil man das Gefühl hat, daß er in Wirklichkeit unsere Zeit kommentiert. Ich machte mich in den nächsten Monaten und Jahren zugleich lächerlich und verdächtig, indem ich überall herumerzählte, die Hauptstadt der »letzten europäischen Diktatur«, wie Belarus im Bewußtsein des bescheidwissenden Westmenschen einzig und allein vorkommen zu dürfen schien, sei eine der schönsten und interessantesten, die ich je gesehen hätte. Ich bereitete mich damals innerlich schon darauf vor, meine Ruhestandswohnung in Berlin zu beziehen, als ein Anruf der Personalabteilung kam. Man finde momentan niemanden, der das Goethe-Institut in Minsk leiten wolle, und ob ich mir nicht vielleicht vorstellen könne, das kommissarisch ein Jahr lang zu machen, bis man eine endgültige Besetzung gefunden habe.
[...]
SINN UND FORM 1/2021, S. 5-20, hier S. 5-8
