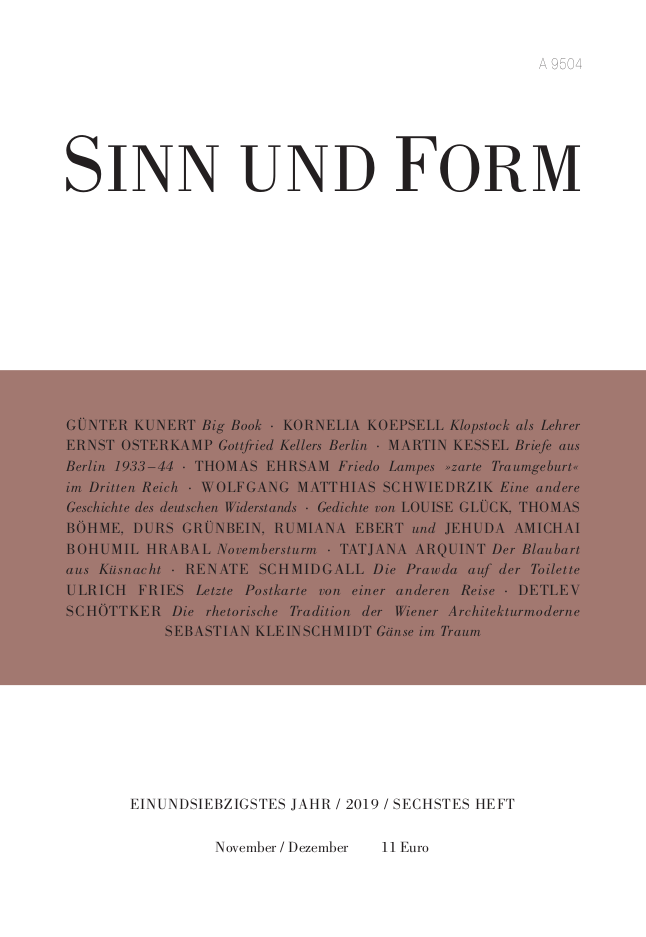
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-50-8
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 6/2019
Kessel, Martin
Der städtische Robinson und sein Dämon der Idylle. Eine Vorbemerkung zu Martin Kessel, »Versuchen wir, am Leben zu bleiben«. Briefe aus Berlin 1933-44. Mit einer Vorbemerkung von Till Greite
Man könne inmitten Berlins »als städtischer Robinson« wie in einer Wildnis leben: Als Martin Kessel diese aphoristische Bemerkung 1948 veröffentlichte, fand er damit das existentielle Bild für eine Daseinsform im Schutt, für das Leben in der untergegangenen Reichshauptstadt. Ein Schiffbruch zu Lande, eine beginnende, ein halbes Jahrhundert dauernde Insellage und die Fraglichkeit eines Überlebens im »unfreiwilligen Exil«, wie der Kritiker Friedrich Luft die Nachkriegszeit nannte – all das umfaßt die Robinsonade inmitten Berlins. Kessel prägt diese Denkfigur noch im Krieg, in der hier erstmals abgedruckten Briefauswahl aus den Jahren 1933 bis 1944, die mit dem Bild des Durchbruchs auf den städtischen »Meeresgrund« schließt, wie Kessel dieses Leben in einer Stadt am Nullpunkt später nannte. Werner Heldts malerische Stilleben haben jenes Lebensgefühl im Wrack der Stadt, das auch Kessel mit seinen Aphorismen und Essays umkreist, sinnfällig ins Bild gesetzt: Es gibt kaum Menschen in dieser ville morte, nur vereinzelt Kähne, eremitenhafte Scherbengänger im Schutt.
Kessel lieferte den geistigen Proviant für diesen Gang durch die Ruinen, eine Moralistik, die beides sein wollte: Vademecum gegen Verrohung und sokratischer Anstoß, das Erlebte nicht ad acta zu legen, wohl wissend, daß gerade die Flucht ins Vergessen allzumenschlich ist: »Wir tragen eine funkelnde Wildnis in uns, die Wildnis des Vergessens.« In der Katastrophenidyllik der stillgelegten Zentrale Berlin erspürte Kessel bereits das »vergletscherte Schweigen«, in das die Deutschen sich einsargten. Gleichwohl stellte er im Sinne Friedrich Nietzsches auch die Frage nach den Grenzen emotionaler Berühr- und Belastbarkeit: »Die rabiate Totalvernichtung dringt nicht mehr zum Herzen«, konstatiert er in seinem aphoristischen Kompendium »Gegengabe« (1960). Das Vergessen, so heißt es in einer Miniatur mit dem Titel »Sanatorium der Wildnis« (1970), sei nach traumatischen Erfahrungen nur durch eine »Kur des Stumpfsinns« zu erkaufen. Ein feinsinniger Autor wie Kessel wußte, daß die Hornhaut des Vergessens, jene mit dem Überleben oft einhergehende Desensibilisierung, Gift für alles Schöpferische ist, gerade für die Literatur. So heißt es über den schmerzhaften, jedoch notwendigen Rückweg zu den Quellen eigener Erfahrung: »Nicht vergessen darfst du, um gelebt zu haben.«
Ganz im Zeichen solcher Schadensaufbewahrung steht diese Aphoristik, die darin einen Gedanken Nietzsches aus seiner »Fröhlichen Wissenschaft« (1882) über die Tücken der Überlieferung aufgreift. Denn Kessel war sich, wie der letzte Brief dieser Auswahl zeigt, seiner Rolle als Hermes und Überlieferungsfigur ebenso bewußt wie seines Schicksals, daß er womöglich in Vergessenheit geraten sollte. Doch die Ströme der Überlieferung haben ihr eigenes Maß und so hinterließ dieser Wahrheitszeuge seine Deutungssplitter. Gerade auf sein Werk und dessen Stellung zwischen den Epochen mag insofern Nietzsches Wort zutreffen: »Die Vergangenheit ist vielleicht wesentlich noch unentdeckt!« Martin Kessel gehört hierbei zu jener von der Literaturgeschichte vernachlässigten Generation der um 1900 Geborenen, die von totalitären Erfahrungen besonders heimgesucht wurde und sich mitunter in ihre unheilvolle Zeugenschaft verstrickte. Es war eine verlorene Generation, eine, die der »Teufel geholt« hatte, wie Wolfgang Koeppen 1962 anläßlich seiner Rede zur Verleihung des Büchnerpreises bemerkte. Zu ihr zählten Peter Huchel, Koeppen selbst, Marie Luise Kaschnitz und Hermann Kesten; mit den beiden letzteren war Kessel freundschaftlich verbunden. Sein bekanntestes Buch ist der Roman »Herrn Brechers Fiasko« (1932), der für ihn selbst zu einem solchen wurde. Dessen Sujet hatte er als Phänomenologe des Pflasters, wie er in einem Brief an Siegfried Kracauer bekannte, »von den Straßen« Berlins gesammelt. Der Roman fiel ob seines unruhigen Geisteswitzes, seines strapaziösen Stils durch, der den Zug zur aphoristischen Pointe bereits erkennen ließ. Ein Stil, der es in Kauf nahm, Leseerwartungen auf die Probe zu stellen. Aber er wurde ihm auch zum gefährlichen politischen Desaster, wie der hier abgedruckte erste Brief nach der »Machtergreifung« von 1933 deutlich macht. Gerade ob seiner geistigen Wendigkeit wurde der Autor des Brechers, im Zeichen zunehmend gleichgeschalteter Kritik, als »noch jüdischer als ein Jude« diffamiert und abgelehnt. Daß Kessel dies überhaupt in einem Brief aufgriff, deutet auf seine parodistische Natur und seinen unabhängigen Geist hin. Seine ethische Haltung bestand darin, sich noch im Moment der Bedrängnis seine Freiheit zur Komik zu bewahren.
Kessel wurde 1924 mit einer Arbeit über Thomas Mann promoviert und war mithin das, was man einen poeta doctus nennt. Er war kein publikumswirksamer Schriftsteller, sondern einer, der in die Literatur hineinwirkte, den vor allem Kollegen schätzten, wie Briefe in seinem Nachlaß von Thomas Mann über Alfred Döblin bis Heimito von Doderer belegen. Das deutete sich schon in seinem ersten Gedichtband »Gebändigte Kurven" (1925) an, in dem die Großstadt als überwältigende Erscheinung durchs lyrische Ich fährt wie einst die Straßenbahn durch den Leib von Rilkes Brigge. Der Lyriker und Kritiker Oskar Loerke bemerkte 1927 in einer Besprechung dieses Bandes, daß Kessel die Großstadt nicht nur illustriere, sondern daß sie bei ihm regelrecht mitspreche. Mit ihm sei einer aufgetaucht, der den Poeschen »Mann der Masse« kenne, ein Autor, der die Stadt im Wort vollziehe. So einer dürfe kein »gebürtiger Berliner« sein, wie Loerke über den Autor schrieb, welcher aus der sächsischen Provinz nach Berlin gezogen war. So einer müsse, um seine scharfe Auffassungsgabe zu behalten, ein vertrauter Fremder, ein Außenseiter im Innenraum der Stadt bleiben. Damit traf Loerke einen wichtigen Punkt: Wir dürfen annehmen, daß Kessel seinerseits, in seinem Essay »Gogol und die Satire«, ein Stück Selbstbeschreibung mit der Aussage liefert, der satirische Exzentriker nach Gogol stehe niemals im Zentrum des Geschehens, sondern spreche von den Rändern her. Überdies scheint ein Gutteil von Kessels Figurenpersonal dessen berühmtem »Mantel" entstiegen zu sein. Der Satiriker-Moralist – das belegen alle Romane Kessels – lebt vom Spannungsverhältnis zwischen Zentrum und Peripherie. Er hat eine tiefe Ahnung von den komischen Ambivalenzen des Lebens und kennt seine eigene Veranlagung zur »Wollust der Angst«. Er entdeckt ein dämonisches Berlin, wie schon E. T. A. Hoffmann oder Walter Benjamin vor ihm, seine Alltagsidyllen sind vom Grauen durchzogen.
Spätestens mit der Eskalation des Krieges hat Kessel nicht nur etwas vom drohenden Gang zum Äußersten gespürt, sondern dies in Form einer Kassiberliteratur, einer Form des verdeckten Schreibens, wie Dolf Sternberger dies später nannte, auch zum Aus- druck gebracht. Eine fast burleske Anspielung findet sich im zweiten hier abgedruckten Brief an seine Frankfurter Freunde, die Eickemeyers, wo er über seinen Gedichtband »Erwachen und Wiedersehen« (1940) sagt, darin sei zwar manch »burschikoses«, aber ansonsten alles »die reinste natur«. Gerade die Naturlyrik war im Nationalsozialismus ein oft gewähltes allegorisches Mittel des verdeckten Schreibens. So heißt es im Gedicht »Romantischer Abend«, ein »blutiger Besen« gehe durch die Stadt, in der »Trauernde im Nebel ruhn« – eine mögliche Anspielung auf Pogrome und Deportationen. Und wie eine Flaschenpost an die Zukunft heißt es in der Coda: »Manches wird die Welt einst lesen / wenigen offenbart sich’s gleich.«
Der »teufel« sei bei ihm los gewesen, schreibt Kessel in dem Brief vom 28. März 1940, nachdem er von einem Mitarbeiter seines vormaligen Braunschweiger Verlags Vieweg denunziert worden war. Dort hatte er seinen an die Schauerromantik erinnernden Künstlerroman »Die Schwester des Don Quijote« sowie den Essayband »Romantische Liebhabereien « (beide 1938) veröffentlicht. In letzterem spricht er wieder von Nietzsche, dessen »Übermensch« von einer skrupellosen Kulturpolitik »fälschlicherweise zur Attrappe erhoben und ausgemünzt wurde«. Deutlicher kann man sich kaum gegen seine Indienstnahme durch den Nationalsozialismus verwahren. Aber den Ausschlag für die Denunziation beim Propagandaministerium gab womöglich etwas anderes, nämlich das Schlußgedicht der Sammlung »Erwachen und Wiedersehen« mit dem bezeichnenden Titel »Hohe Bereitschaft «, in dem auf riskante Weise der Aufruf zum Tyrannenmord angedeutet wird: »Bei soviel Opfern, soviel Blut / als Pfand, das im Gedächtnis ruht«. Den günstigen Augenblick – »ihn gilt’s nicht zu versäumen«. Es war wieder Loerke, der in einer Rezension mit seinem Geistesverwandten Kessel Zwiesprache hielt und dessen Sinn fürs »Zeitgefühl" lobte. Loerke, eine der wichtigsten Stimmen der inneren Emigration in Berlin, schrieb in seinem Gedicht »Der Steinpfad«: »Und meine Gegenwart ist Scham.« Daß es aber ausgerechnet der mit der Zensur des Bandes beauftragte Mann im Propagandaministerium war, den Kessel ironisch für »gar nicht übel« befand und der offensichtlich nicht viel Aufhebens machen wollte, hatte selbst eine satirische Note, die die Erwartung unterlief. Diese Wendung offenbart zugleich einen tiefernsten Zug, den der deutsch-britische Essayist und Lyriker Michael Hamburger nach dem Krieg auf den Begriff der »demons of conformism" brachte, auf die sich jede totalitäre oder autoritäre Herrschaft stützt und die im Falle des Nationalsozialismus auf vorauseilenden Gehorsam setzte. In diesem Falle jedoch, das ist die Ironie, wurde er von einer höheren Stelle abgefangen. Damit wird Kessels heikle Zeugenschaft um so deutlicher: Denn er wußte, wie Konformismen entstehen und was für Unheil sie gebären. Er sollte nach dem Krieg erleben, wie diese zum Argument der Selbstentlastung, zu Tarnkappen des Jedermann wurden.
Kessels Schilderung in dem Brief wirkt so, als befände er sich in einem Schelmenroman, und die bedrohliche Zeit könne ihm nicht wirklich etwas anhaben. Daß dem nicht so war, sondern daß er sich in einer Art Schutzmantel verbarg, deutet der spätere Essay »Vom Geist der Satire« (1947) an. Darin heißt es, die Haltung des Lächerlichen gehöre ins Clair-Obscur des Allzumenschlichen, nicht zuletzt in Zeiten existentieller Bedrängnis. So sprach für Kessel im Satirischen – in seiner an Helmuth Plessner erinnernden anthropologischen These – immer Angstvolles mit. Das satirische Bewußtsein, das sich im Grenzaffekt des Lächerlichen Luft verschafft, sei selbst Ausdruck einer Krise: Denn gerade in Grenzsituationen werde der Ernst abgewertet, um sich die existentiell zudring- liche Wirklichkeit buchstäblich vom Leibe zu halten. Der Mensch verstehe es, »lächerlich zu werden aus purer Angst«. Kessel, der durch einen Unfall nur ein Auge besaß, war somit als ein Versehrter in der Sphäre des Menschlichen ein überaus hellsichtiger Zeuge.
Der mutigste und weitblickendste Essay aus der NS-Zeit trägt den unscheinbaren Titel »Die Patenschaft der Vergangenheit« (1938), in ihm schreibt Kessel gegen den Gegenwartsopportunismus aus »Zynismus und Gewagtheit« an. Bemerkenswert ist, daß hier einer zugibt, ein »schlafloses Wesen« geworden zu sein angesichts der sich auftürmenden »Gebiete von Schuld und Gewissen«. So deutlich wie kaum je sonst benennt Kessel hier die Machenschaften des NS-Regimes und mahnt: »Jenes machiavellistische Widerspiel, das aus Diplomatie das Verbrechen heiligt, jene Forderungen von Opfern an Blut und Leben, jener Blick aufs Ganze über den Einzelnen weg – wie sollte dies zu verantworten sein und vor wem, wenn nicht vor der Instanz einer höheren und späteren Gerichtsbarkeit. « Wer sich fragt, wo das Gewissen der Literatur, ihre aufrichtige Zeugenschaft, zu finden gewesen sein mag, kann hier fündig werden. Für den aufmerksamen Leser wird bereits jene Kippfigur sichtbar, als die Kessel das Nachkriegsberlin sah: ein Ort, der immer wieder vom Idyllischen ins Schreckliche umschlägt. Wer also die Vergangenheit dem Vergessen überlasse, der begehe eine »Amputation« am Zeitsinn des Menschen und zugleich an dessen ethischem Vermögen. Wer hingegen sein inneres moralisches Empfinden vom Einspruch der Überlieferung berühren lasse, für den könne das »Vergangene als Widerstand« gegen die Zumutungen seiner Zeit einstehen. Es ging Kessel darum zu zeigen, daß die Einsicht in unsere Verstrickung in die Zeitläufte nicht ohne ethische Konsequenz bleiben darf.
An dieser Haltung scheint auch die Erfahrung des großen Luftangriffs im November 1943 nichts geändert zu haben, der weite Teile des Neuen wie des Alten Westens südlich des Tiergartens in ein Trümmerfeld verwandelte. Gleichwohl ist eine Gemütsverwandlung vom Satirischen zur tragischen Gefaßtheit merklich angesichts der das Fassungsvermögen sprengenden Zerstörungen. Auch Kessel stockt nun der Geisteswitz. Es scheint, als habe die sich in der Mitte der Stadt ausbreitende Leere seine Ahnungen furchtbar bestätigt. Diese »leere Zentrale«, die sich vor ihm als städtischem Robinson vom Fehrbelliner Platz bis Stadtmitte ausbreitete, war nur die manifeste Form eines locus terribilis, der ihm das zeitgenössische Berlin atmosphärisch schon zuvor gewesen war. Die pulsierenden »Konzentrationspunkte« der Stadt, die er in »Herrn Brechers Fiasko" noch beschrieben hatte, waren zu gespenstischen Kratern implodiert. Es war zudem eine Implosion des geistigen Berlin, verbrannte doch vor seinen Augen in Gestalt des Romanischen Cafés das »Haus der Literatur« aus Weimarer Tagen. So geht dieser Trümmerflaneur wie Nietzsches »toller Mensch« durch die Ruinen und versucht die grauenvolle Leere, an der seine Mitmenschen nur schweigend und wie anästhesiert vorbeischleichen, zu begreifen. In der Mitte herrsche Totenstille: »Menschen stehen herum, ziehen in nicht allzu dichten Strömen aneinander vorbei, es fällt kein Wort.« Ähnlich wie Felix Hartlaub und Friedo Lampe versuchte Kessel diese apathische Stimmung wenn nicht zu überwinden, so doch zum Ausdruck zu bringen. Der Luftkrieg hatte – mit einem Wort aus Karl Friedrich Borées Roman »Frühling 45« – eine gigantische »Vakuole« ins Herz der Stadt geschlagen. Kessel beschreibt ihn nun als ein Herausfallen aus allen Orientierungsachsen, mit dem das Erleben nicht mehr Schritt hält: »Ich weiß einfach nicht, wie ich das mitteilen soll«. Nicht zufällig, sondern aus innerer Not griff Kessel auf die kleine Form zurück, um wenigstens »einige Fäden in der Hand zu halten«, wie er in seinem Brief an seinen Freund Richard Gabel bekannte. So wurde der Aphorismus zum Sinnbild komprimiertester Erfahrung im Zeichen der Daseinsnot: »Wo jeder Tag der letzte sein kann, gewinnt der Augenblick eine unendliche Größe.«
Nach dem Krieg trat Kessel vor allem als Aphoristiker und Essayist in Erscheinung, abgesehen von dem Roman »Lydia Faude« (1965), den er noch in der NS-Zeit begonnen hatte und der ihm, in der Anlage zwischen den Epochen stehend, wieder zum Publikumsfiasko werden sollte. Von der Titelfigur heißt es darin, ganz in Sinne einer Allegorie Nachkriegsberlins, daß sie zwar Vergangenheit habe, »vielleicht mehr, als sie bewältigen kann, aber sie lebt nicht mit ihr, sie strebt von ihr fort. Sie lebt in bezug auf eine Art Fata morgana, es ist alles Wüste.« Als Aphoristiker genoß Kessel einen legendären Ruf in den Feuilletons. Er sei der »Eremit in Berlin«, schrieb ein Kritiker 1963 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, quasi ein Zarathustra von Wilmersdorf, der zu seiner Zeit und zu literarischen Gruppierungen auf Abstand ging. So gewann er als Außenseiter dem genius loci der Stadt auch im Nachkrieg Entscheidendes ab: Er brachte ihn in seinem Skizzenband »In Wirklichkeit aber« (1955) auf den »Dämon der Idylle«. In der unheimlich stillen Ruinenstadt lägen die »Konzentrationspunkte«, in Wiederaufnahme eines komplett gewandelten Ausdrucks aus dem Brecher-Roman, »weit auseinander« oder seien, »wie der Potsdamer Platz, durch politische Injektionen narkotisiert. Es ist also keine idyllische Stille, es ist eher eine, diabolisch und paradox, mit einer lautlosen Stimme begabt, die sagt: ›Ich sehe hier vieles, das nicht da ist, nicht mehr und noch nicht.'« Als einen Seher zwischen den Zeiten, in der Tradition Nietzsches, sah Kessel sich selbst, den im Schutt seine eigene »stillste Stunde«, Gewissensruf des Überlebenden, ereilte.
Kessel fand mit seinen Gedankensplittern somit auch die zeitgemäße Form für den Daseinszustand der Stadt. Für ihn sei Berlin noch Kosmos, befand ein Kritiker, »wie es bei Benjamin in der ›Berliner Kindheit‹ und bei Döblin im ›Alexanderplatz‹ Kosmos war«, nur eben in Form einer in Stücke gebrochenen Ordnung. Der »Überlebende«, bekannte Kessel einmal, sei dabei von »zweifelhafter Redlichkeit (…) gemessen am Schweigen der Opfer«. Doch wußte er, daß es ihm nicht erspart bleiben würde, seinen Weg im Ausdruck zu suchen, allein schon um für sich und Kommende »gelebt zu haben«.
SINN UND FORM 6/2019, S. 780-797, hier S. 780-784.
