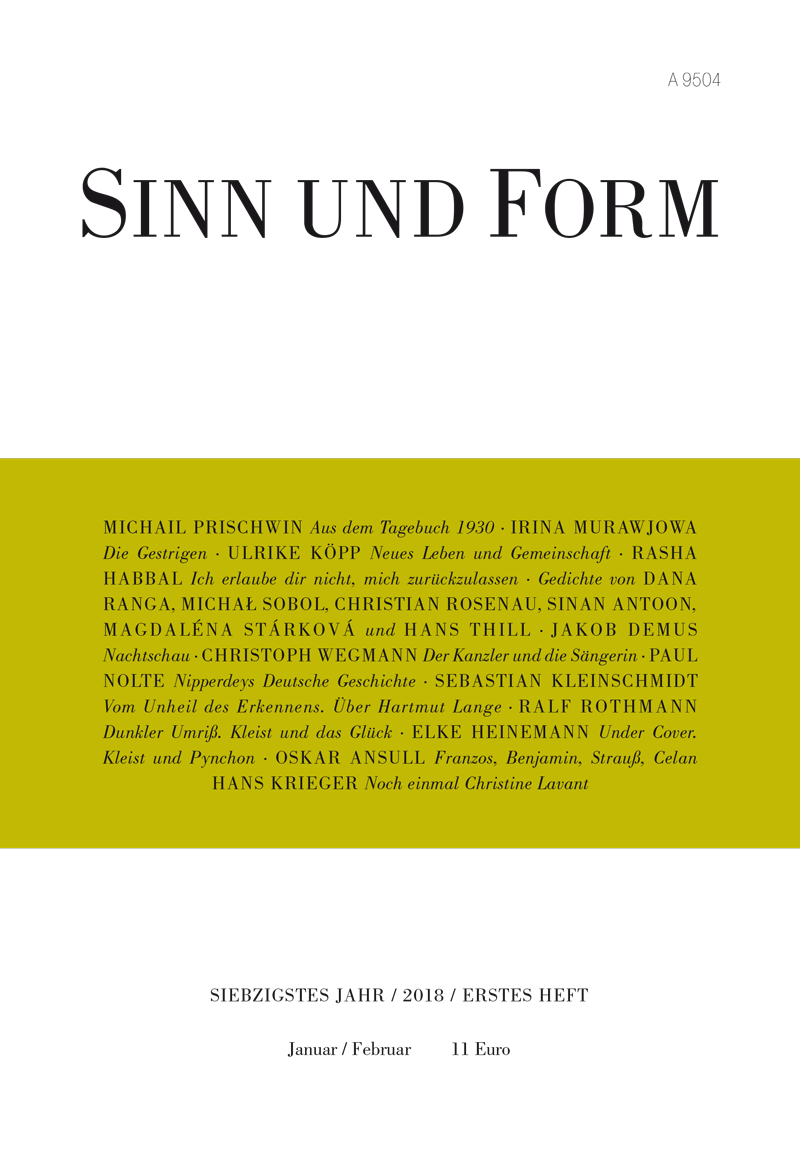Leseprobe aus Heft 1/2018
Prischwin, Michail
»Glücklich unsere Erben, die unsere Zeit nur lesen werden.« Aus dem Tagebuch 1930. Mit einer Vorbemerkung von Eveline Passet
Vorbemerkung
Ich kann der Gesellschaft nur aus einem Abstand zu ihr in versunkenem Nachdenken nützlich sein.
1. Juni 1928
Wie soll man dagegen sein! Nur ein Verrückter kann sich unter die Lawine stellen und denken, daß er sie aufhält. Mir vormerken: In ein Umfeld gehen, wo aufgebaut und an etwas geglaubt wird.
28. Oktober 1929
Die Revolution beraubt den Menschen seines individuellen Schicksals.
24. Dezember 1930
Michail Prischwin (1873 –1954) ist dem Leser, in Rußland wie jenseits seiner Grenzen, vor allem als Kinderbuchautor bekannt und als »Sänger der russischen Natur« – ein Titel, den er Maxim Gorki verdankt. In den deutschen Sprachraum vermittelte ihn als erster Alexander Eliasberg, der 1914 im Münchener Georg Müller Verlag eine Auswahl früher Erzählungen vorlegte. Den Kulturvermittlern in der Sowjetischen Besatzungszone und der frühen DDR galt Prischwin, da offiziell zwar anerkannt, doch ideologisch wie stilistisch fern jedem sozialistischen Realismus, als probater Autor, um das deutschsprachige Publikum an die Sowjetliteratur heranzuführen; allerdings betrieb kein Verlag in Ost oder West kontinuierliche Werkpflege. In der DDR erschien noch das eine oder andere, meist aber wurde bereits Übersetztes neu herausgebracht. Prischwins einziger Welterfolg war und blieb »Ginseng. Die Wurzel des Lebens«, verfaßt 1932 / 33, erstmals erschienen 1934. Daß es einen zweiten – gleichwohl vom Naturschilderer nicht zu trennenden – Prischwin gibt, den Beobachter und Bedenker der Menschen und des Menschengemachten, entging der Öffentlichkeit. Und es mußte ihr entgehen: Der Autor, der seit 1905 Tagebuch schrieb, tat dies ab 1917 im verborgenen, auch im engsten Umfeld wußte bis zuletzt nur seine zweite Frau davon. Eine einbändige, thematisch geordnete Auswahl ohne Datumsangaben, die 1960 unter dem Titel »Nesabudki« (Vergißmeinnicht) erschien, konnte nicht – und durfte wohl auch nicht – das tradierte Bild korrigieren. Möglich machte dies erst die Perestrojka: Zwischen 1991 und 2017 wurden Prischwins Tagebücher in 18 Bänden mit mehr als 13 000 kleingedruckten Seiten ediert. Sie umfassen drei russische Revolutionen, den Großen Terror, den Zweiten Weltkrieg, das erste Jahr nach Stalins Tod und bilden ein Mosaik aus Alltagserlebnissen, Begegnungen mit berühmten Persönlichkeiten wie einfachen Menschen, aus Betrachtungen zu Literatur, Religion, Politik, Philosophie, aus Träumen und Selbstbeobachtungen, Naturschilderungen, Briefkonzepten, literarischen Entwürfen, Haushaltsfragen, Überlegungen zur Beziehung der Geschlechter etc. Vor allem aber verzeichnen die Tagebücher immer wieder kleine und kleinste Mutationen des politisch-gesellschaftlichen Lebens und deren Niederschlag im Alltag, im Individuum, im Zwischenmenschlichen, in der Sprache. Dieses gigantische diaristische OEuvre entsprang dem Willen, den eigenen Blick, das eigene Fühlen und Denken, die eigenen Wertvorstellungen, die eigene Sprache freizuhalten von den Korruptionen, denen viele aus mangelnder Widerstandskraft oder aus Angst erlagen – oder zu denen sie durch ihren Glauben an die Revolution verführt wurden. Auch Prischwin gelang es nicht, von den politischen und sprachlichen Topoi des neuen Regimes gänzlich unberührt zu bleiben. So notiert er am 14. November 1930: »Sechs Jahre habe ich an der ›Kette des Kaschtschej‹ [einem autobiographischen Roman] geschrieben in der Hoffnung, unser Land stünde vor einer Wiedergeburt, die ich als einträchtiges gemeinsames Schaffen eines guten Lebens verstand. Mein Vorgefühl hat mich getrogen, wie sich zeigt, ist der Weg bis zu einem ›guten‹ Leben in freiem Schöpfertum noch weit (…)« Zugleich endet der Eintrag mit der Feststellung, daß ihm »die ›Notwendigkeit‹ mit ihrem Realismus « jetzt näher sei »als die ›Freiheit‹ mit ihrer Illusion und Romantik«.
In den Jahren der Leninschen »Atempause« (der Neuen Ökonomischen Politik) und noch 1928 erlaubte sich Prischwin bei aller abständigen Skepsis Hoffnung. Es ist das Jahr, in dem der erste Fünfjahrplan zur Förderung der Wirtschaft in Kraft tritt, die Zeitschrift »Oktjabr« Scholochows »Der stille Don« und Ilf und Petrows »Zwölf Stühle« abdruckt, der wie Grigori Sinowjew und Dutzende andere linke und rechte Oppositionelle aus Politbüro und Partei ausgeschlossene Lew Trotzki nach Alma-Ata verbannt wird, Sergej Eisensteins Film »Oktober« in die Kinos kommt und Maxim Gorki nach siebenjähriger Abwesenheit erstmals wieder sowjetischen Boden betritt. Von Prischwin erscheinen die Bände 3 bis 6 einer auf sieben Bände angelegten Werkauswahl, die, noch ehe der letzte Band herauskommt, 1929 in die 2. Auflage geht. Seine immer wieder aufkeimende Hoffnung auf eine bessere Zukunft verdankt sich seinem früh in einer persönlichen Krise erworbenen Credo der Lebensbejahung, auch dann, wenn Wirklichkeit und persönliche Verzweiflung eher dessen Verneinung nahelegen (Suizid gedanken begleiten ihn bis ins Jahr 1940). Dem augenscheinlich Bösen, Katastrophischen, Sinnlosen einen Sinn abgewinnen, es nicht als das Äußere, Überwältigende, Andere zu betrachten, sondern es als Teil der eigenen lebensweltlichen Wirklichkeit durch teilhabende Beobachtung und distanzschaffendes Schrei ben ins tägliche Dasein zu integrieren – diese Haltung half ihm bereits, die Bürgerkriegsphase zu überstehen. Nach einem zweiwöchigen Gefängnisaufenthalt – man hatte ihn zusammen mit Führungspersonen von »Wolja Naroda« (Volkswille, einer Zeitung der Sozialrevolutionäre, für deren Literaturbeilage er schrieb) verhaftet – notierte er am 30. Januar 1918: »Jetzt ist klar, daß es unmöglich ist, im Namen der menschlichen Individualität gegen die Bolschewiki anzutreten: Der Bottich brodelt und wird bis zuletzt brodeln, man kann höchstens an den Rand des Bottichs treten und überlegen: ›Wie, wenn ich mich auch hineinstürzte‹?« Der Bottich ist bei Prischwin eine Metapher für persönlichkeitslose Räume, für die Geschichte und das kollektive ("östliche«) Wir.
Er selbst wird sich nicht hineinstürzen, sondern dicht am Rand des Bottichs stehenbleiben. Im Frühjahr 1918 zieht er wieder ins heimatliche Chruschtschowo, ein Dorf nahe Jelez im Gouvernement Orjol, wo er versucht, auf einem ererbten Stück Land, auf dem er ein Haus gebaut hat, als Lehrer, Jäger und Selbstversorger mit Frau und zwei Kindern durchzukommen. Doch die Mushiki verjagen ihn schon im Herbst: Es war die Zeit der »schwarzen Umteilung«, in der Landlose nach Gutdünken Enteignungen durchführten. 1920 / 21 darbt Prischwin als Lehrer in Alexino (Smolensker Gebiet), wo er im einstigen Adelssitz der Baryschnikows das »Museum des Gutslebens« einrichtet. Er hungert, geht auf die Jagd und läuft viele Werst in die Stadt, um für seine Dorflehrerration zu kämpfen. Was immer ihm begegnet, notiert er im Tagebuch: Natureindrücke, den Mushiki Abgelauschtes, in deren Dialekt sich Vulgarismen mit Biblischem und verdrehtem Bildungswortschatz ("Antilligenz«) mischen, die Gestik der Revolutionäre, den verunglückenden Sowjetsprech und die Gewaltexzesse der neuen lokalen Machthaber, häusliche Szenen, und dazu nicht selten christlich-apokalyptisch gefärbte Reflexionen über all dies. 1922 verdichtet er, was ihm in Chruschtschowo und Alexino widerfuhr, in wenigen Monaten zu einer schauerlich wahren Groteske, ganze Tagebuchpassagen finden nahezu unverändert Eingang in die Erzählung »Der irdische Kelch«, über die Trotzki, auch wenn er ihr »großen künstlerischen Wert« bescheinigt, das Todesurteil verhängt: »Ganz und gar konterrevolutionär«. Eine vollständige und unzensierte Fassung des Buches liegt erst seit 2004 vor.
Aber noch in den schwärzesten Phasen sucht und findet Prischwin den Augenblick des Innehaltens und Zurücktretens, der Schönheit, der Harmonie, des Aussetzens der jagenden Zeit: das Idyll. Das Idyll nicht als Flucht aus Gesellschaft und Geschichte (also als innere Emigration), sondern im Gegenteil als Rebellion: als beharrliches Erinnern an eine andere Dimension des Daseins – des Seins als solches. Das um so unbeirrter gepriesen werden muß, je mehr es bedroht ist. Er selbst spricht nicht von Idyllen, sondern von »phänomenischen« Notaten und Skizzen. Auch in seinen Romanen schreibe er letztlich »otscherki«, jene nur ungenügend mit »Skizze« übersetzbare Kleinform, die nah an realen Begebenheiten bleibt, sie aber derart verdichtet, daß ein verborgener Sinngehalt hervorgetrieben und das Geschehnis transzendiert, aus seiner Einzelfallhaftigkeit erlöst wird. Tatsächlich ist jedes Tagebuchnotat mal mehr, mal weniger sprachlich-stilistisch durchgestaltet, und die Diarien erscheinen im Ablauf der Tage merklich komponiert. So entsteht Eintrag um Eintrag ein fünfzig Jahre umspannender chronikalischer roman fleuve, dessen Protagonist durch eine Zeit grauenvoller Irrungen und Wirrungen geht, eine Zeit, die Tag für Tag, Jahr um Jahr von den Menschen gelebt wurde, vom einzelnen, der seine Hilflosigkeit, sein Ausgesetztsein erfährt, dem vielleicht eben nur diese eine Chance bleibt: einen Ort zu finden, den er freihalten kann von dem System reiner, vollendeter Tatsachen, die Zeit und Raum und Geist bis an den äußersten Rand füllen und füllen sollen.
Prischwin hat diesen Ort im diaristischen Schrei ben gefunden. »Der Kampf vom Lachen bis zum Schrei und den Tränen über die eigene Person wird für alle gebraucht – darin besteht mein Weg in der Literatur. Deshalb hat mich der im Wasser zappelnde Schmetterling beschäftigt: Das bin ich! Folglich muß der Schmetterling gerettet werden«, notiert er am 18. Juni 1937. Dieser Ort des Rückzugs, der Raum des diaristischen Schreibens, erweist sich auf dialektische Weise zugleich als derjenige Ort, an dem man sich auf die Zumutungen des Faktischen mit allen geistig-seelischen Konsequenzen einlassen kann und an dem sich andere Erkenntnisse gewinnen lassen als im »Bottich« (in den sich etwa ein Ilja Ehrenburg warf): Man erlebt sich – noch eine dialektische Volte – als hineinverwickelt, widersprüchlich, zerrissen, fehlgehend: »Im Politischen irre ich mich beständig, weil ich mir meine Urteile aus Material bilde, das mein Herz mir zuträgt, mein Verstand wagt nur im Verein mit dem Gefühl aufzutreten«, konstatiert er am 21. Juli 1929, »deshalb sind meine Urteile im Politischen stets kleinbürgerlich und unsicher.«
Deutlich wird diese Unsicherheit etwa in Prischwins zwiespältiger Haltung gegenüber den Mushiki, dieser Lumpenbauernschaft, die zwischen 1917 und 1922 zu einem plündernden und mordenden gesellschaftsfeindlichen Mob wurde. Ihm zog er, so brutal sie ihrerseits war, die bolschewistische Staatsmacht vor, schien sie doch ein Minimum an Ordnung zu garantieren. Als er 1928 / 29 in Sagorsk (Sergijew Posad) lebt und viel auf dem Land unterwegs ist, fühlt er sich erneut an die Zeit des Kriegskommunismus erinnert: »Dem Mushik ›die Freiheit geben‹«, vermerkt er am 21. August 1928, »bedeutet, ihm die Freiheit zur Zerstörung zu geben.« Gut ein Jahr später, am 1. November 1929, schreibt er: »Das äußere Bild erinnert sehr an 1918, damals allerdings wurde das Plündern mit der Revolution gerechtfertigt: ›Plündere den aus, der dich ausgeplündert hat‹, heute mit dem sozialistischen Aufbau der Zukunft. Damals saß auf jedem Posten ein überzeugter Revolutionär, heute nur noch ein Exekutivbeamter, Überzeugte gibt es nicht mehr. [durchgestrichen: Die Welt hat in der Geschichte alle Arten von Raub und Plünderung gesehen, aber so etwas, daß jeder Werktätige ausgeraubt wird zugunsten der faulenzenden ›Armut‹ und die Bürokraten mit dem Wort ›wer nicht arbeitet‹ … Widerlich, daran zu denken.]« Drei Tage zuvor hatte er notiert: »Selbst wenn es eine Akkumulation der Produktionsmittel, von Traktoren und anderen Maschinen gibt, so zahlt den Preis dafür die Bevölkerung durch Verarmung. Die Frage ist bloß, was zuerst eintritt: Machen die Maschinen die Armen glücklich und reich, oder zerstören die Armen in äußerster Verzweiflung die Maschinen? Warten sie oder nicht?«
Michail Prischwin betrachtete seine Tagebücher als sein Hauptwerk. Zu Recht: Sie sind Zeitchronik und Zeitroman in einem, sind durch die Wahrnehmung eines einzelnen gegangene und in unterschiedlichem Maße literarisch verdichtete Mitschriften der Ereignisse. Dieser einzelne – man kann es sich denken – ist zu keinem Zeitpunkt ein innerlich entschiedener oder gar sich offen bekennender Gegner des Regimes, doch ebensowenig ein Befürworter. Gerade das öffnet sein Ich auf all die anderen einzelnen, die unter den Bedingungen von Revolution, Krieg, Bürgerkrieg und Stalinismus lebten.
Der folgende Auszug stammt aus dem Jahr 1930, das am 5. Januar mit dem ZK-Beschluß »Über das Tempo der Kollektivierung und die staatlichen Hilfsmaßnahmen beim Kolchosaufbau « begann. Am 30. Januar folgte der Beschluß »Über Maßnahmen zur Liquidierung der Kulakenwirtschaft und zur Durchsetzung der Kollektivwirtschaft«, am 25. April der »Über die Konsolidierung der Situation in den Arbeitslagern«. In Sogorsk wurden im Januar die Glocken von den Kirchtürmen gestürzt. Prischwin hat dieses »Glockensterben « im Tagebuch und auch auf Fotos festgehalten. Er selbst gerät als Mitglied der Schriftstellergruppe Perewal in die Kritik. In Moskau wurde am 2. Februar eine Ausstellung zu Majakowski eröffnet, der gut zwei Monate später den Freitod wählte; Isaak Brodski malte »Lenin im Smolny«, und im Bereich der Literatur erschienen Arkadi Gajdars »Die Schule des Lebens«, Marietta Schaginians »Das Wasserkraftwerk«, Iwan Bunins »Das Leben Arsenjews«, Andrej Platonows »Die Baugrube« sowie, im Berliner Exilverlag Slowo, Vladimir Nabokovs Roman »Lushins Verteidigung«.
Eveline Passet
SINN UND FORM 1/2018, S. 5-27, hier S. 5-9