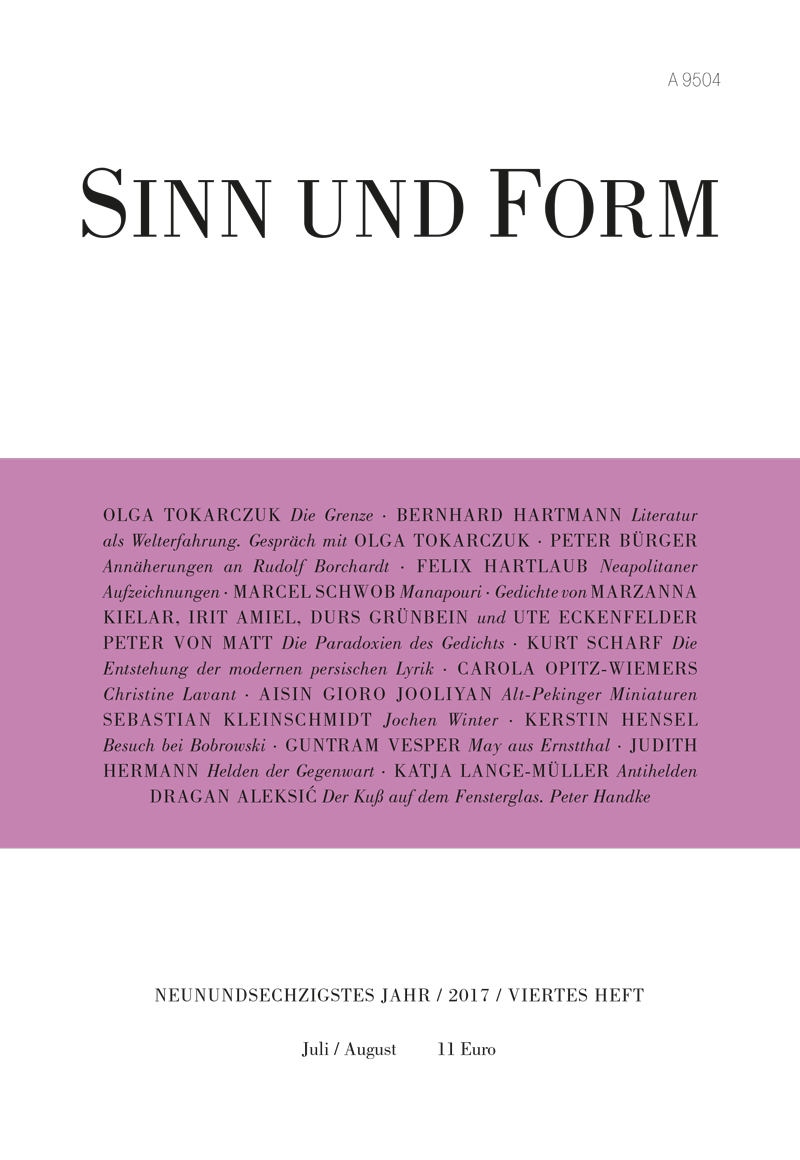Leseprobe aus Heft 4/2017
Schwob, Marcel
Manapouri. Eine Seereise nach Samoa 1901/ 02
Vorbemerkung
Am 21. Oktober 1901 schiffte sich in Marseille der Schriftsteller Marcel Schwob zu einer Reise ein, von der er sich vor allem zwei Dinge erhoffte: Heilung von der Krankheit, die ihn seit Jahren niederdrückte, und neue Impulse für sein Schaffen. Der aus Chaville bei Paris gebürtige Autor hatte 1891 mit dem Erzählungsband »Das gespaltene Herz« debütiert und dann praktisch jedes Jahr einen solchen veröffentlicht – die bekanntesten sind »Das Buch von Monelle« und »Der Roman der zweiundzwanzig Lebensläufe«. Außerdem schrieb er für verschiedene Zeitungen und galt in seinem literarischen Umfeld, zu dem André Gide, Paul Valéry, Alfred Jarry, Paul Claudel, Colette, Jules Renard und der »cher Maître« Stéphane Mallarmé gehörten, als ungewöhnlich sprachbegabt, belesen und brillant.
Die aussichtsreiche Laufbahn endete 1896 mit seiner Erkrankung, die ganz unterschiedlich diagnostiziert und behandelt wurde. Ein Arzt erklärte wenige Monate vor der Reise, seiner Meinung nach seien mit Ausnahme der Lunge und vielleicht des Herzens alle inneren Organe krank, und es werde schwierig, ihn zu retten. Nach mehreren erfolglosen Operationen war Schwob um 1900, Berichten zufolge, stark abgemagert, morphiumabhängig und nur mehr ein Schatten seiner selbst. Ein einziger literarischer Text entstand noch, die Erzählung »Der Sternenbrand«, ansonsten blieb es bei vereinzelten wissenschaftlichen Arbeiten, etwa zur Biographie François Villons. Auch als Übersetzer trat er gelegentlich hervor (Shakespeare, Stevenson, De Quincey).
Wegen seiner schwachen Gesundheit und Reizbarkeit suchte Schwob fortwährend Ruhe – Grund zahlreicher Umzüge in Paris sowie mehrerer Erholungsaufenthalte auf Jersey, in diversen Badeorten oder in Italien. Doch stets sah er sich in seinen Erwartungen getäuscht. Schließlich empfahl einer der konsultierten Ärzte einen längeren Aufenthalt auf See, und Schwob entschloß sich zu einer Art Grand Tour. Seinem amerikanischen Freund Vincent O’Sullivan schrieb er, eine vage Einladung zum Mitreisen aussprechend: »Um den ersten Oktober herum breche ich wieder auf. Wohin? Gott weiß es. Ich denke an Australien, Queensland, die Meerenge von Torres; vielleicht Samoa. Würde Sie das reizen? Ich glaube nicht. Mir selbst kommt das sehr wichtig vor, ich schreite zu meiner finalen Behandlung. Wenn ich nach sechs Monaten nicht geheilt bin, gebe ich alles auf.« (Undatiert, Spätsommer 1901)
Samoa – der Name, der scheinbar so beiläufig fällt, war für Schwob allerdings bedeutsam. Von dort hatte ihm sein verstorbener Brieffreund Robert Louis Stevenson geschrieben, ein veritabler Bruder im Geiste und Widmungsträger seines ersten Buches. Ohne Zweifel kannte Schwob, der jede Zeile von ihm las, Stevensons Reisebericht »In der Südsee« (1896), den dieser während der Arbeit daran erwähnt hatte (»Es soll und wird das große Buch über die Südsee werden«, 19. August 1890). Schon der Anfang von Stevensons Bericht muß für den Schwerkranken wie eine Verheißung geklungen haben: »Nahezu vier Jahre ging es mit meiner Gesundheit bergab, eine Zeitlang vor meiner Ausreise glaubte ich, der letzte Abschnitt meines Lebens sei gekommen, und nur Krankenschwester und Totengräber warteten noch auf mich. Man riet mir, ich solle es einmal mit der Südsee versuchen, und ich war nicht abgeneigt, wie ein Geist oder Gespenst in jenen Gegenden aufzutauchen, die mich einst in Jugend und Gesundheit entzückt hatten.«
So vermischten sich in Schwobs Reiseplänen Heilungs-, um nicht zu sagen, Erlösungssehnsucht, Abenteuerlust und Stevenson-Verehrung. Seine Mutter und vor allem sein älterer Bruder Maurice, Leiter des in Familienbesitz befindlichen Zeitungsverlags in Nantes, kümmerten sich um die Vorbereitung. Begleitet wurde er von seinem chinesischen Koch und Krankenpfleger Ting-Tse-Ying, den er im Vorjahr nach dessen Tätigkeit auf der Pariser Weltausstellung angestellt hatte. Der Arbeitsvertrag sah unter anderem vor, daß Ting seinen Dienstherrn zu rasieren habe und dieser im Falle von Tings Ableben für die Überführung der sterblichen Überreste nach China sorgen müsse.
Schwob wußte, daß er seiner Familie mit der Reise ein großes finanzielles Opfer auferlegte, und machte Anstalten, sich mit dem Titel eines Korrespondenten für »Le Temps« an den Kosten zu beteiligen. Tatsächlich ist kein einziger Artikel von ihm erschienen, auch in anderen Zeitungen nicht. Genausowenig verwirklicht wurden von Schwob erwähnte literarische Projekte mit erkennbarem Samoa-Bezug (»Océanide«, »Vaililoa« und »Captain Crabbe«). So blieben die Briefe an seine Frau der einzige Ertrag der Reise. Obgleich nicht zur Veröffentlichung bestimmt, sollten sie wohl als Grundlage eines möglichen Buches dienen. Die erste Ausgabe des »Voyage à Samoa« betitelten Korpus erschien 1930 unter Mitwirkung der Witwe, ist aber fehlerhaft und unvollständig. Auch die sonst sehr sorgfältig nach den Manuskripten ergänzte Ausgabe von 2002 enthält zumindest einen Brief nicht, der mit einem Teilnachlaß an die Brigham-Young-Universität in Utah gelangte.
Die Schauspielerin Marguerite Moréno, die Schwob 1900 ehelichte, galt als Muse der Symbolisten und wurde besonders von Dichtern für ihre Sprechkunst geschätzt. Sie überlebte ihn um Jahrzehnte, machte in den fünfziger Jahren noch eine bemerkenswerte Alterskarriere und verkörperte u. a. die »Irre von Chaillot« bei der Uraufführung des gleichnamigen Schauspiels von Jean Giraudoux.
Schwobs Briefe offenbaren das allmähliche Scheitern des mit so großen Hoffnungen begonnenen Reiseprojekts: Mit der »Ville de La Ciotat« geht es durch den Suez-Kanal nach Djibouti und weiter nach Colombo. Einen vierzehntägigen Aufenthalt in Ceylon nutzt er zur Erkundung der Insel und besonders der Ruinenstädte. Hier machen sich trotz der Euphorie erste Anzeichen von Erschöpfung bemerkbar. Den größten Verdruß bereitet ihm ungewollt sein Mitreisender Ting: Als sie nach Sydney weiterreisen wollen, weigert sich der Zahlmeister des »Polynésien« zunächst, ihn mit an Bord zu nehmen. In Australien gehen die Behörden (wie heute wieder) drakonisch gegen vermeintliche chinesische Einwanderer vor und verlangen horrende Kautionen, ehe sie den zwischenzeitlich selbst erkrankten Ting ein- bzw. ausreisen lassen.
Die Weiterfahrt nach Samoa beschert Schwob nach »Tagen schwärzester Melancholie« immerhin die Begegnung mit Kapitän Crawshaw, der Stevenson noch kannte und ihn an Bord der »Manapouri« mit vielerlei Geschichten unterhält. Auch die ersten Tage in Apia gestalten sich vielversprechend: Schwob besucht den alten König Mataafa, erhält diverse Einladungen, beginnt Samoanisch zu lernen und findet sich – wie früher Stevenson – in der Rolle eines tusitala bzw. tulafala (Geschichtenerzählers bzw. -schreibers) wieder. Dann aber wirft ihn eine Lungenentzündung nieder, die er nur mit knapper Not überlebt. Geldmangel und andere Hindernisse verzögern die ersehnte Heimfahrt. Durch Zufall erfährt er schließlich, daß die »Manapouri« wieder auf Reede liegt, und läßt Crawshaw von seiner Lage in Kenntnis setzen. Der nimmt den völlig Mittellosen mit zurück nach Sydney, von wo er weiterreisen kann. Am 20. März 1902 trifft Schwob, der sich inzwischen »wie ein vivisezierter Hund« fühlt, wieder in Marseille ein. Das mutmaßliche Ziel der Pilgerfahrt, Stevensons Wohnsitz in Vailima und sein Grab auf dem Mount Vaea, hat er wohl nicht gesehen. Er stirbt knapp drei Jahre später, mit Siebenunddreißig, in Paris. Fast scheint es, als habe der Name von Crawshaws Schiff der Reise das geheime Motto vorgegeben: Manapouri bedeutet in der Maori-Sprache »Kummervolles Herz«. Der erwähnte Schriftstellerkollege Vincent O’Sullivan nannte Schwobs Samoa-Fahrt Jahrzehnte später »eine der ungemütlichsten Reisen, die seit den Tagen des Odysseus von einem Sterblichen unternommen wurden«.
Gernot Krämer
Mittwoch, 23. Oktober [An Bord der »Ville de La Ciotat«]
Der gestrige Tag war furchtbar. Ein ununterbrochenes Stampfen bei drückender Luft. Das Deck ähnelte dem Floß der Medusa: nichts als blasse und entkräftete Gestalten. Jede Viertelstunde schleppt sich eine arme Nonne (von denen es vier gibt) aufs Deck, um sich über die Reling zu erbrechen. Obwohl ich mich zeitweise auch unwohl fühlte, zwang ich mich zu essen und habe schließlich trotz des hohen Seegangs gut gespeist. Natürlich sind bei Tisch weiterhin die »Saiten« aufgespannt, und nicht viele kommen zum Diner, das kannst Du mir glauben. Es ist eine schreckliche Überfahrt. Endlich gegen sieben Uhr brach das Unwetter los. Im Westen ein blutroter Sonnenuntergang mit fächerförmig gestreiften Wolken, der den Himmel zu einem ausstaffierten Baldachin machte und sich verschwommen in der Dünung spiegelte. Das Meer schäumend, dunkles Saphir. Im Südosten erhellten gewaltige, überlange, gezackte Blitze den ganzen Horizont; erloschen sie, wirkte das Wasser wie eine dunkle Wüste, in die das Schiff eintauchte; sogleich durchzitterte eine Art elektrisches Leben Wasser und Himmel und Schaum und die große Ebene aus geschmolzenem Saphir.
Als ich um halb zehn schlafen ging, war Ting seekrank. Ich schlief recht gut, heute morgen ist der Himmel bedeckt und das Meer ist stürmisch und farblos, Rollen und Stampfen wirken zusammen. Wir machen anscheinend fünfzehn Knoten pro Stunde und sollen laut Plan morgen abend, Donnerstag den vierundzwanzigsten, gegen sechs in Port Said eintreffen. Ich muß mir Kleider in Weiß oder Khaki kaufen: Das Rote Meer, so heißt es, ist nur in dieser Uniform zu ertragen. Gott weiß, daß ich mich nicht aus eigenem Geschmack so kleiden werde.
Am selben Tag. Zwei Uhr.
Das Wetter hat sich geändert; es ist schön, und ich widerstehe nicht länger der Herrlichkeit des Ionischen Meeres. Hier reicht die Wirklichkeit an die Vorstellung heran. Der blaßblaue Himmel ist mit kleinen weißen Schäfchen übersät, das unnütz plätschernde Meer von einem unbeschreiblich tiefen Blau; das Wasser ist aus geschmolzenem Saphir und indischem Saphir, wie Dein Ring. Eben schaukelte fünfhundert Meter entfernt an Backbord ein ganz weißes Schiff über dieses saphirfarbene Geplätscher, die hohen Segel fischnetzartig aufgespannt. Es glich einer Seemöwe, die ihr Gefieder spreizt. Und rechts von der weißen Möwe, hinter einem See aus flüssigem Saphir, die Berge Kretas, karg wie Pyrenäengipfel, grüngefleckt und dunstverhangen – langgestreckte Berge, die nach Osten ansteigen, ein einziges strahlendweißes Haus an einem gelblichen Paß; dann noch höhere Gipfel, deren glitzernde Felswände sich in leichten Wolken verlieren.
Unsere Position deutet darauf hin, daß wir am morgigen Donnerstag erst gegen Mitternacht in Port Said sind, zu spät, um etwas einzukaufen, denn wir bleiben nur drei, vier Stunden. Der nächste Hafen ist Djibouti, dort kann ich wieder Post aufgeben. Hoffentlich kann ich in Port Said wenigstens ein Telegramm abschikken, damit Du Nachricht hast, bevor Dich dieser Brief erreicht.
Auch die Dummheit der Passagiere reicht, wie die Herrlichkeit des Ionischen Meeres, an die Vorstellung heran. Hier ein Gespräch zwischen drei Herren der besten Gesellschaft, die jeden Abend im Smoking erscheinen; ich habe es gestern von meinem Sessel aus verfolgt.
A: Mein Lieber, haben Sie »Quo Vadis« gelesen? Das ist schön, was? Da gibt es Beschreibungen …
B: Ja, ja, und ich habe »Mit Feuer und Schwert« gelesen. Bewundernswert, diese Polen. Und so munter bei den Gemetzeln, was? Und die vier Helden … Mein Lieber, wissen Sie, woran die mich erinnern, diese vier? Die haben mich erstaunlicherweise an die »Drei Musketiere« erinnert. Aber das da stellt alles in den Schatten.
C: Ich hab’ das alles auch gelesen. Aber es ist nicht leicht mit den vielen Leuten.
Also … Poppäa war doch Cäsars Frau, nicht wahr?
A: Ach, es gibt so viele von den Cäsarn … Aber macht nichts, Sicossié (Sienkiewicz) ist schon ein Pfundskerl. Ach, noch was, Salenbeau (Salammbô) – also, der Aufmarsch der Armeen mit der Beschreibung all der unterschiedlichen Völker – also, das ist herrlich. Ach, Salenbeau ist richtig gut! Aber Sicossié ist unvergleichlich. Da gibt es Gemetzel, mein Lieber …
B: Ja, ja. Ich hab’s mir im Theater angesehen, »Quo Vadis«, mir hat es nicht gefallen.
A: Weil sie es nicht richtig gemacht haben. Das habe ich doch gleich gesagt … Die herrliche Szene in der Arena spielen sie hinter der Kulisse. Wenn sie uns das gezeigt hätten, bei der Sportbegeisterung heutzutage: die Arena, die antiken Spiele, mein Lieber …
B: Ja, aber die Bühne im Porte Saint-Martin … Man hätte schon das Hippodrom gebraucht.
C: Ja, ja, das Hippodrom!
A: Pah! Pah!
C (einen Notizblock hervorziehend): Übrigens wurde mir was zu lesen empfohlen. Es soll ganz lustig sein. Es heißt »Das Gastmahl des Trimalchio«. Von Petron.
A (verächtlich): Dann ist es eine Übersetzung. Außerdem ist es nicht von Sicossié, wissen Sie. Mein Lieber, Sie müssen »Mit Feuer und Schwert« lesen. Stimmt’s?
B: Ja, ja. »Die drei Musketiere«, sage ich Ihnen!
A (mit der Zunge schnalzend): Ah, dieser Sicossié!
Länger habe ich nicht zugehört.
(…)
Aus dem Französischen von Gernot Krämer
SINN UND FORM 4/2017, S. 480-495, hier S. 480-484