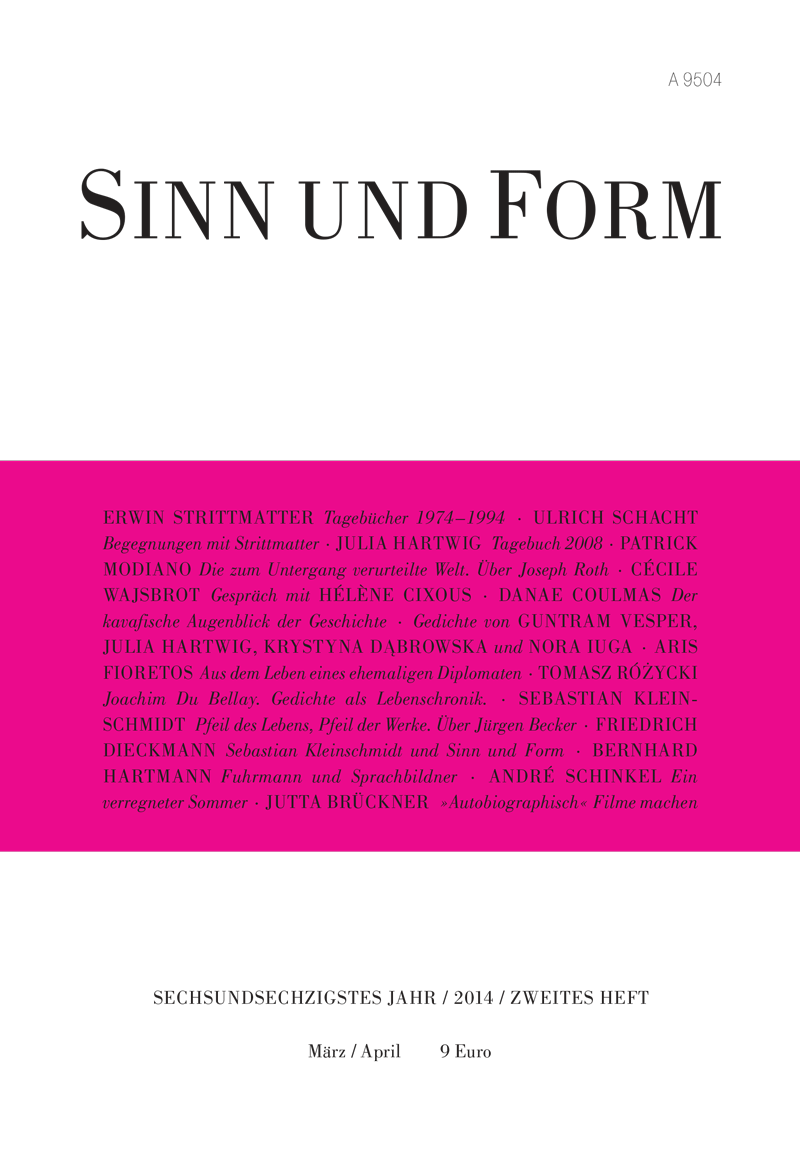Leseprobe aus Heft 2/2014
Różycki, Tomasz
GEDICHTE ALS LEBENSCHRONIK
Über Joachim Du Bellay
Ich weiß nicht, warum ich diese Gedichte gefunden habe, die Frage ist sogar etwas absurd. Von allen möglichen Gründen, potentiellen und realen Verkettungen von Ereignissen scheint die einzig wahre und – bei aller Paradoxalität – einzig sinnvolle Antwort zu lauten: Die Gedichte haben mich gefunden. So ist es wohl mit allen Lektüren – unser Unterbewußtsein wartet nur darauf, sich im Licht der weißen Blätter zu enthüllen, die schwarzen Buchstaben dienen ihm als Weckruf. Und weil ich nichts über mein Unterbewußtsein weiß, denke ich lieber, die Gedichte hätten mich gefunden. Sie haben mich gefunden – aus einem fragwürdigen Grund, über den ich mir nicht ganz im klaren bin, den ich aber herausfinden möchte, weil es eine so ernste Sache ist. Meine Intuition in bezug auf Dichter (auch tote, insbesondere tote) und Dichtkunst sagt mir, daß es kein ganz unschuldiger Grund sein wird, daß es zu Berührungen kommen wird, zu Ausbeutung, nächtlicher Stickluft oder gar nächtlichem Ersticken, womöglich wird auch Blut getrunken. Bestimmt wird Blut getrunken. Auf jeden Fall geschieht etwas Fragwürdiges. Und genau das will ich beobachten.
Die Gedichte haben mich gefunden, aber natürlich habe ich auch auf sie gewartet. Das heißt, etwas in mir hat gewartet, etwas, das eben durch sie geweckt wurde und von dem ich bis dahin nichts wußte. Jetzt kann ich nur noch versuchen, dem nachzuspüren, den Spürhund zu spielen, der in der Dunkelheit lauert und beobachtet, wie zwei Gestalten im blassen Licht des Mondes ihre Streiche beginnen. Zwei Gestalten, eine aus dem Nichts aufgetaucht, die andere im Dunkeln auf sie wartend. Beide gleich blaß und merkwürdig.
Man weiß nicht viel über das Leben ihres Autors, Joachim Du Bellay. Nicht, daß seine Biographie gänzlich unbekannt wäre. Wir kennen einige der wichtigsten Ereignisse, aber jedes Mal, wenn ich etwas darüber lese, kommt es mir vor, als bleibe die Hauptperson gänzlich »unberührt« in ihrem Geheimnis, als hätten die Biographen keinen Zugang zu ihrem wahrem Leben, als passe ihre, wie Sartre sagen würde, Existenz nicht zu der in ein paar Dutzend Sätze gefaßten Essenz, die ihm andere zuschreiben. Sitzt Du Bellay also in Sartres Hölle, irrt seine Seele noch immer umher und fleht um Befreiung?
Er kam 1522 zur Welt, wie Pierre de Ronsard als Sohn einer reichen Familie: Seine Onkel und Vettern machten Karriere, und einer seiner Verwandten spielte in Du Bellays Leben später eine wichtige Rolle. Der Junge war von Geburt an kränklich, aber das ist in Dichterbiographien nichts Besonderes. Ehe er zehn wurde, verlor er Vater und Mutter. Von da an stand er unter der Vormundschaft seines älteren Bruders und hatte, wie die Biographen schreiben, »eine traurige Kindheit«, der Bruder vernachlässigte zunächst seine Bildung, erst später studierte Du Bellay in Poitiers Jura, was ihm die Aussicht auf eine Anstellung als Sekretär beim Cousin seines Vaters, einem Kardinal, eröffnete.
Geboren wurde er im Schloß La Turmelière, unweit von Liré im Anjou. Liré liegt an der Südseite der Loire – der Fluß ist nah, nur eine Viertelstunde entfernt. Ich war einmal in der Gegend, damals wußte ich noch nichts von Du Bellay; die Loire strömt breit dahin, sie ist flach und heiter, auf den Sandinseln im Fluß wachsen Bäume und Sträucher, entlang des Wegs Pappeln, ihre flauschigen Flugsamen legen sich in so dicken Schichten auf die Steinbrücke, daß man hindurchwaten muß. Zwischen sanften grünen Hügeln die Ruinen eines Schlosses aus dem fünfzehnten Jahrhundert: Hier lebte Du Bellay. Zwanzig Jahre zwischen diesen Hügeln. Die Franzosen nennen diesen Landschaftstyp bocage – gemeint sind durch Baumreihen abgeteilte Felder. Man findet sie in ganz Nordeuropa, von der Bretagne bis nach Masowien.
Angeblich nahm sein Leben eine Wende, als er an einem Sommertag in einem Wirtshaus an der Loire Ronsard kennenlernte: Beide waren zwanzig, beide schrieben Gedichte, beide hatten Soldaten werden wollen und diesen Plan wegen früher, schnell voranschreitender Taubheit aufgeben müssen – solche Zufälle gibt es nur einmal, wollen wir also die Sache näher betrachten. Zwei fast taube junge Dichter, zwei der größten Dichter aller Zeiten. Derselbe Ort und dieselbe Zeit. War Taubheit etwas Normales in dieser Zeit, diesem Milieu, dieser Gegend? Befiel sie vielleicht insbesondere Personen, die ihr Leben der Arbeit mit Rhythmus, Reim und Melodie widmeten? Oder bewirkte umgekehrt die fortschreitende Taubheit, die Beeinträchtigung des Gehörs von früher Kindheit an, daß die betroffene Person um so mehr nach Klängen, nach Musik forschte und sie auch schuf? So wie Beethoven? Ronsard wollte von Anfang ein großer Dichter werden – deshalb schrieb er. Du Bellay wurde von ihm angesteckt. Beide gingen nach Paris, am Collège Coqueret unterrichtete sie der Hellenist Dorat, dort lernten sie die Antike und Petrarca kennen. Mit Freunden gründeten sie eine Dichtergruppe. Erst nannten sie sich La Brigade, später La Pléiade.
Du Bellay wurde recht schnell bekannt – erst durch sein berühmtes Manifest über die französische Sprache und die neue Dichtkunst ("Défense et illustration de la langue française«), dann durch seine lateinischen Gedichte und seine Sonette; er wurde zum französischen Ovid und zum französischen Petrarca, wurde anfangs sogar mehr gepriesen und geschätzt als Ronsard. Aber das Wichtigste stand erst noch bevor. Die Sonette und anderen Gedichte, die Du Bellay in Paris schrieb, waren eigentlich nur Fingerübungen, ein wenig langweilig und gekünstelt (war er wirklich verliebt oder pflegte er bloß die Tradition des Petrarca-Sonetts?), Fingerübungen für das, was später kommen sollte. Die Besonderheit dieser Gedichte war, daß sie in Französisch geschrieben waren; sie führten neue Gattungen in die Lyrik ein und ahmten alte, antike Autoren nach. Dazu kamen Konvention und Abstraktes, Mythologie und Courtoisie, Pose und Manier. Wahrscheinlich bin ich furchtbar ungerecht; ich werde es bis zum Ende dieses Textes bleiben. Der Band mit Sonetten wurde für eine gewisse Olive geschrieben, worin manche ein Anagramm des Namens der Mademoiselle de Viole sahen. Doch Olive wie auch Viole bleiben geheimnisvoll und literarisch. Über keine von beiden wissen wir etwas Genaues – sowenig wie über Petrarcas Laura. Olive kann ein Name sein oder die Frucht, ein Verweis auf den Süden, auf die Provence oder eben auf Petrarca. Viole ist ein mehrdeutiger Name: Er bezeichnet ein Instrument (damals die Viola da Gamba), klingt aber auch nach Gewalt.
Just als Du Bellay berühmt und am Königshof gelesen wurde, begannen seine finanziellen und gesundheitlichen Probleme (der Ausbruch der Schwindsucht, die Verschlechterung des Gehörs). Es eröffnete sich aber auch eine außergewöhnliche Chance: eine Reise nach Rom als Sekretär seines Verwandten, des Kardinals, in geheimer politischer Mission. Eine wahrlich formidable Chance für jemanden, der die italienische und lateinische Literatur liebte. Er konnte zur Quelle seiner Inspiration vordringen, die Wiege der Antike und der Renaissance sehen, in der Hauptstadt der Welt leben. Dieser Moment, der Moment, in dem er Frankreich verließ, war – glaubt man den Biographen, aber insbesondere auch seinen späteren Gedichten – das größte Unglück seines Lebens.
Die Enttäuschung kam schnell. Sicher, anfangs war Rom schön und faszinierend, aber schon bald begann ihn die Arbeit zu ermüden – er verbrachte sinnlose Stunden damit, sich um die Angelegenheiten und Ausgaben des Kardinals zu kümmern, die Höflinge des Kirchenstaats waren noch weitaus schlimmer als ihre Pariser Pendants, die Priesterschaft, die ganze kirchliche Hierarchie war (glaubt man den Gedichten) eine Bande gemeiner, neidischer und bis ins Mark verdorbener Leute, Italienisch und Latein gingen ihm auf die Nerven. Aus Frankreich kam die Kunde von Prozessen und vom Verlust des Vermögens, vor allem aber von den Erfolgen der Pléiade-Kollegen. In Rom kannte niemand den Dichter Du Bellay, hier hielt man ihn für ein Nichts. Also schrieb er Nacht für Nacht, zunehmend krank vor Sehnsucht, Melancholie, Groll und Langeweile, Sonette nach dem Vorbild von Ovids »Tristia«, die er später »Regrets« (Klagen) nannte. Welch ein Paradox: Rom wurde für Du Bellay zum Verbannungsort. Rom, die Hauptstadt der Kultur, wurde ihm zur Wüste, zu einem Gefängnis wie Ovids Tomis. Und wie Ovid Rom nachweinte, weinte Du Bellay Frankreich nach und flehte um die Erlaubnis, die Ewige Stadt zu verlassen.
[...]
Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann
SINN UND FORM 2/2014, S. 247-255, hier S. 247-250