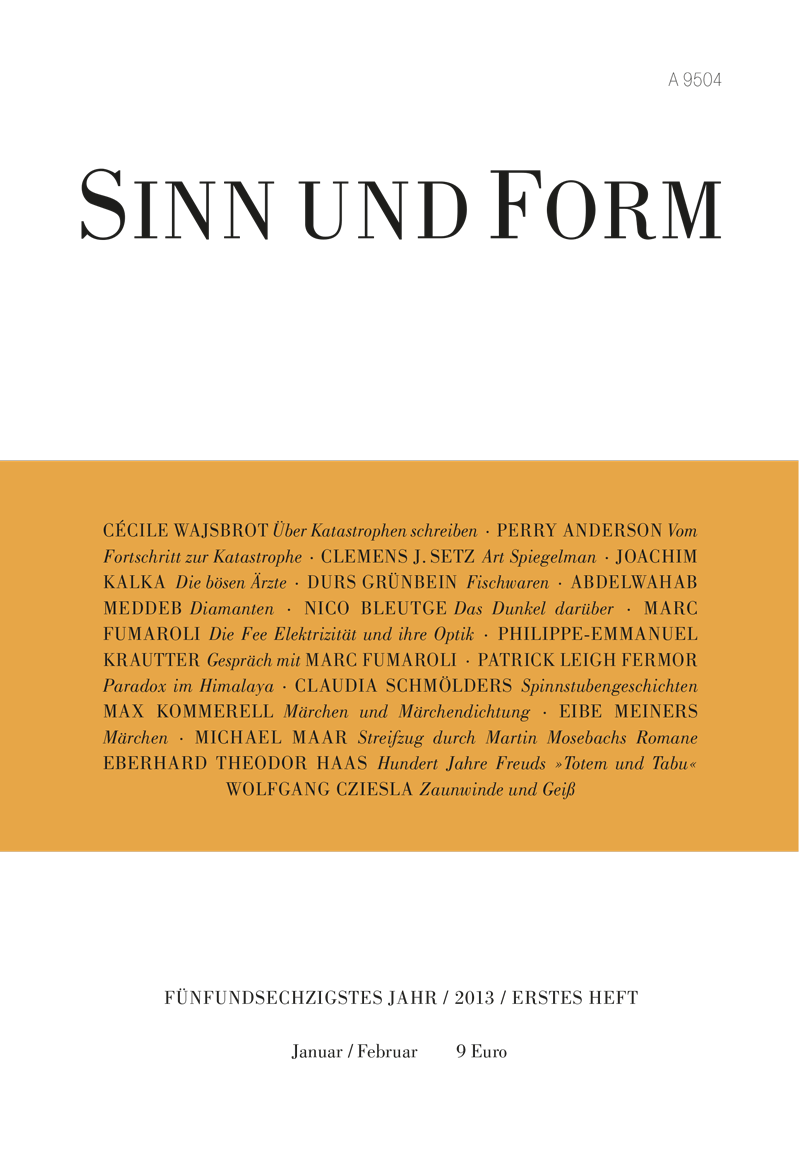Leseprobe aus Heft 1/2013
Kalka, Joachim
Die bösen Ärzte
Eine Montage
Wissen Sie nicht, was die erste Pflicht des Mediziners ist?
Die erste Pflicht ist es, um Verzeihung zu bitten.
Ingmar Bergman, »Wilde Erdbeeren«
Auch damals ihr, ein junger Mann,
Ihr gingt in jedes Krankenhaus,
Gar manche Leiche trug man fort,
Ihr aber kamt gesund heraus.
Goethe, »Faust I, Vor dem Tor«
Von keinem anderen Berufsstand erwarten wir, wenn es darauf ankommt, so viel wie von den Ärzten. Unsere Hoffnungen heften sich, sind wir einmal aus der bewußtlosen Routine unseres unauffällig funktionierenden Organismus herausgerissen und stehen – liegen! – krank oder verwundet da, flehend und fordernd an die ärztliche Kunst. Da der Arzt diese Hoffnungen oft nur begrenzt erfüllen kann, wird er uns gelegentlich zur verhaßten, in schwarzen Farben gemalten Figur. Die Vernunft sagt uns, daß es Krisen und Katastrophen des Körpers gibt, bei denen ärztliche Kunst nichts oder nur sehr wenig vermag. Gut, aber sagt sie uns nicht auch, daß die Medizingeschichte selbst beweist, wie viele Pfuscher, Ignoranten und Sadisten es unter den Ärzten gibt? Das gilt für jeden Beruf, sagt die Vernunft, deren Stimme, wie Freud bemerkt hat, leise ist. Wir aber sehen, sind wir angstvoll mißgelaunt, lieber »den Arzt« schlechthin als höchst unzuverlässige Gestalt. Dies geschieht in wechselnden Graden mit allen Berufen, von der Witzblattkomik des Installateurs, der für den Wasserrohrbruch immer erst nächste Woche Zeit hat, bis zur schneidenden Justizsatire bei Daumier oder Karl Kraus. Kein Berufsstand aber scheint das Mißtrauen so anzuziehen wie die Ärzte. Eine Wurzel dieses Mißtrauens liegt in der Neigung der Patienten, die Möglichkeiten des Arztes zu überschätzen und dann enttäuscht zu sein.
Lange blieb der Medizin nicht viel anderes übrig, als die Unzulänglichkeit und Kärglichkeit ihrer Mittel durch Spekulation und Pittoreskes zu ergänzen – mit Begründungen, die (wie der heute noch den Nashörnern verhängnisvolle Analogieglaube) Hoffnungen auf eine geheime Ordnung der Welt zum Ausdruck brachten. Eine barock ausziselierte Vignette derartigen Aberglaubens entsteht, als der Held in Herzmanovsky-Orlandos »Gaulschreck im Rosennetz« (1928) bei einer hexenartigen Hebamme einen Liebestrank bestellt. Die Alte setzt ihm umständlich die Schwierigkeit des Unternehmens auseinander: »auch müsse man den Koth einer unschuldigen, weißen Taube dazutun. Der verfaulte Zahn einer Kindsmörderin, sowie ein Loth getrocknetes Krokodilshirn seien als Beigabe sehr zu empfehlen, letzteres wäre aber selten, – ob er vielleicht wo eins wüßte? Früher hätten die ‚Venedigermanderln’ einen schwunghaften Handel damit getrieben, aber heute … die verfluchte neiche Apothekerordnung …« So führt ein Strang der Medizingeschichte direkt zurück in die Hexenküche; ein anderer in die Jahrmarktsbude. Auch hinter dem marktschreierischen Scharlatanswesen steckt die Suggestion des Dämonischen. Noch eine Schausammlung wie die des Josephinums in Wien mit ihren Wachspräparaten scheint den Besucher in eine Sphäre zurückzuversetzen, wo die ärztliche Wissenschaft in den Zauberkreis des Gruselkabinetts gerät. Bis in die Nachkriegszeit verhießen Jahrmarktszelte Einblicke in die Geheimnisse des menschlichen Leibes – eine schäbig-mysteriöse Inszenierung, wo sich für den halbwüchsigen Besucher die Angst vor Krankheit und Tod mit der sexuellen Ignoranz legierte, wo die Innereien des Menschen ausgebreitet und nebenbei die Stadien der Syphilis erläutert wurden. Werfen wir einen Blick in jene merkwürdige Kuriositätenbude, die ("Zündet der Ägypter nicht schon die Flammen rings um das Zelt an?«) in einer Erzählung von Gustav Meyrink aufragt. Sie liefert Ernst Bloch im Abschnitt »Südsee in Jahrmarkt und Zirkus« des »Prinzip Hoffnung« einen Kardinalbeleg für dämonischen Exotismus in der Jahrmarktswelt. Der Ursprung der monströsen Ausstellung in Meyrinks »Das Wachsfigurenkabinett« (1918) ist in den Aktivitäten eines geheimnisvoll-skrupellosen Mediziners zu suchen, des Persers Mohammed Darascheh-Koh. Dieser diabolische Arzt, der in einer anderen Geschichte Körperteile seines angeblich verstorbenen Feindes als dekorative – auf geheimnisvolle Weise lebendige – Gebrauchsgegenstände in seiner Wohnung angebracht hat ("Das Präparat«), gehört zu einer Reihe von unheimlichen Medizinern, denen man in Meyrinks Sammlung »Des deutschen Spießers Wunderhorn«, dieser Enzyklopädie des Décadence-Horrors, begegnen kann: Dr. Cinderella, Dr. Kassekanari … Es ist interessant, daß Meyrink, für den die aufgeblasene Wichtigtuerei der medizinischen Wissenschaft zu den bevorzugten Gegenständen seiner satirischen Konstruktionen gehört (mit Gestalten wie »Sanitätsrat Mauldrescher«), andererseits dem Mediziner diabolische, schrankenlose Macht attestiert. Hier verspottet er ihn als anmaßenden Ignoranten, zehn Seiten später zeigt er ihn uns flüsternd als grausamen Übermenschen. Meyrink hat in seinen satirischen Erzählungen des öfteren den Arzt als Inkarnation der »aufgeklärten« Stupidität abgebildet ("Der heiße Soldat«, »Blamol«, »Die schwarze Kugel« usw.), doch das Revers dieser Verachtung ist die abergläubische Scheu, die sich in Schreckensgeschichten wie »Die Pflanzen des Dr. Cinderella« oder »Der Albino« ausprägt. So haben wir bei ein und demselben Autor nebeneinander den Arzt als albernen Ignoranten und allwissenden Dämon.
Das gehört auch zusammen. Der fast magische Hochschätzung der medizinischen Möglichkeiten, die den Patienten immer wieder Unmögliches vom Arzt erhoffen (oder befürchten) läßt, entspricht eine sardonische Verspottung der Medizin, mit der man diese entgelten läßt, daß sie den Menschen eben doch nicht unsterblich machen und häufig nicht einmal die Krankheiten (seine Mängel als Naturwesen) beheben kann. Die Satire auf die Ärzte, die vom siebzehnten bis ins zwanzigste Jahrhundert eine reiche eigene Tradition bildet, konzentriert sich auf die dem Arzt nur allzu bewußte Mangelhaftigkeit seiner Möglichkeiten. Ihre zentrale Figur ist der jegliche Unsicherheit aggressiv überspielende Quacksalber, der medizinische Scharlatan, der Gaukler, der vor keiner Versprechung zurückschrickt und – wie im hübschen Couplet des Doktor Eisenbart – machen kann, »daß die Lahmen sehen, / und auch die Blinden wieder gehen«. Hier spiegelt sich die lange Periode, in welcher der Arzt zwar schon ein Beruf mit alter Tradition, das ärztliche Wissen und Vermögen jedoch, gemessen an den heutigen Mitteln, noch äußerst gering war. Der Arzt dieser vergangenen Epoche, der – wie auf zahllosen Bildern, oder als kleine Groteskschnitzerei im Chorgestühl der Oude Kerk zu Amsterdam – das Beschauglas für den Urin (in der katholischen Ikonographie das Requisit, an dem man die heiligen Ärzte Cosmas und Damian erkennt) ernst gegen das Licht hält, übt eine genuine diagnostische Praxis, doch eben diese zeigt die Beschränktheit seiner Möglichkeiten. Das schmale Repertoire der alten Medizin privilegiert, sofern sie nicht gleich zum scharfen Messer und zum glühenden Eisen greift, die ebenfalls recht brachialen Möglichkeiten des Aderlasses und der Purgierung. Es ist ein hübsches Detail, daß der vergiftete und von den ignoranten Medizinern der Garnison bedrängte römische Beamte in »Asterix bei den Schweizern« vor dem Eintreffen des weisen gallischen Druiden sich nichts besseres weiß, als die ihn umdrängenden, streitenden, tobenden Ärzte zu bitten, sie möchten dem Asklepios für seine Genesung einen Hahn opfern: um sie endlich loszuwerden.
Im Städel hängt ein Bild, das Anlaß für ein Gedicht von Wilhelm Busch wurde ("Sahst du das wunderbare Bild von Brouwer?...« in »Kritik des Herzens«). »Die Operation am Rücken« zeigt einen Eingriff, den ein Landarzt oder Bader in einer Wirtsstube vornimmt; das verzerrte Gesicht des Patienten, der im weißen, halb herabgestreiften Hemd auf der Bank sitzt, und die gelassenen Physiognomien des Arztes und der assistierenden alten Frau – diese drei Gesichter, in ein Dreieck gesetzt, sind das eigentliche Sujet. »Ein kühler Doktor öffnet einem Manne / Die Schwäre hinten im Genick; / Daneben steht ein Weib mit einer Kanne, / Vertieft in dieses Mißgeschick.« Busch nimmt die Bildbetrachtung zum Anlaß für eine jener Verallgemeinerungen, die oft nur platt sind, hier aber seltsam plausibel: »Ja, alter Freund, wir haben unsre Schwäre / Meist hinten. Und voll Seelenruh / Drückt sie ein andrer auf. Es rinnt die Zähre, / Und fremde Leute sehen zu.« Mit schöner Beiläufigkeit nimmt Busch die metaphysische Soziologie des zwanzigsten Jahrhunderts mit ihrem Zentralbegriff des »Anderen« vorweg. Bilder von Arztbesuchen gehören in der niederländischen Malerei des siebzehnten Jahrhunderts immer zum Genre, entweder wie hier zum niedrigen, wo ein robustes Handwerk mit grotesk-komischen Zügen geschildert wird, oder zum eleganten. In letzterem erweist sich der Arzt entweder als überflüssig (wie bei den zahllosen Varianten – mindestens achtzehn allein bei Jan Steen – des Topos von der melancholischen Liebeskranken, welcher ärztlich nicht zu helfen ist), oder aber er denkt mit ernster Miene über seine Diagnose nach: eine Nachdenklichkeit, die fast schon Ratlosigkeit bezeichnet. Zeitlose Themen, wenigstens eins aber scheint überwunden: Die theatralisch-liebenswürdige Gebärde des Jahrmarkts-Zahnausreißers auf Genre-Gemälden (etwa von Rombouts, wie in Gent, Münster oder im Prado) ist Geschichte – ein Auftritt mit einer gewissen Suggestion jovialer Eleganz (der Bewegung) und geschmeidiger Ansprache an das Publikum, der immer noch beklemmend wirken kann. Alle, die am Gedanken des »Fortschrittlichen« ganz und gar verzweifeln wollen, mögen nur ein kleines Stück in die Historie zurückgehen, etwa bis zur Zahnarzt-Episode in Wilhelm Buschs »Balduin Bählamm«, um im Kontrast zu unserer örtlich betäubbaren Gegenwart zu erleben, daß es den Fortschritt tatsächlich gibt.
[...]
SINN UND FORM 1/2013, S. 43-46