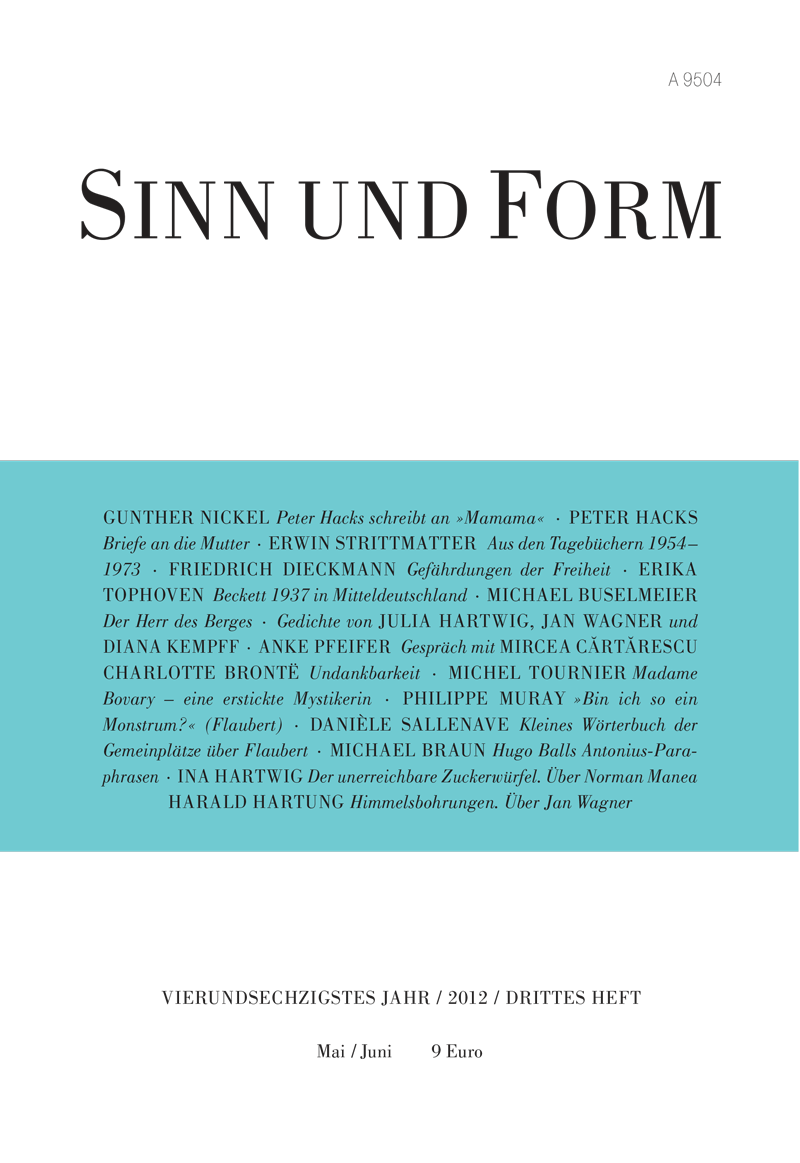Leseprobe aus Heft 3/2012
Nickel, Gunther
»SEITE ENDE, BRIEF SCHLUSS, HERZLICHST PETER«. Peter Hacks schreibt an »Mamama»
Die Entscheidung von Peter Hacks, im Sommer 1955 von Bayern in die DDR zu übersiedeln, muß seine Mutter schwer getroffen haben. Ihr erster Sohn Jakob wohnte mit seiner Familie zwar in Laufnähe, aber die »Mamama«, wie sie in der Familie genannt wurde (und noch heute genannt wird), hing doch sehr am jüngsten, mit dem sie nach dem Tod ihres Mannes im August 1950 allein in der Goethestraße 10 in Dachau lebte. Daß sie ihrem Sohn 1955 das Versprechen abnahm, ihr regelmäßig zu schreiben, gilt in der Familie als gesichert und ist angesichts des ausgeprägten Eigensinns, den Hacks schon in jungen Jahren entwickelte, auch naheliegend. Mitteilungen über Alltäglichkeiten hielt er zeitlebens für überflüssig. In den »Auskünften zur Person«, die er 1990 für André Müller sen. verfaßte, hielt er kurz und bündig über sich fest: »Er ist Schriftsteller; sein Leben enthält keine äußeren Ereignisse.« Obwohl es ihm im Grunde lästig war, fügte er sich dem Wunsch der Mutter. So begann ein regelmäßiger Schriftverkehr, der von zahllosen Paketsendungen von Dachau nach Ost-Berlin begleitet war.
Nicht wenige der Sohnesbriefe enthalten Einkaufslisten oder ausführliche Würdigungen der eingetroffenen Waren: Käse, Rosinen, Pampelmusen, Schokolade, Mixed Pickles, Marshmallows ("Besonders richtig waren die Marshmallows. Wir wollen Marshmallows. We want Marshmallows.«), Nüsse, Gelatine, Oliven, Fruchtkonfekt, diverse Teesorten (bevorzugt von Dallmayr), »Klo-Rollen«, »Fuß-Frisch"-Sprays, Waschmittel-Eimer der Marke Dash oder Schminkutensilien für Anna Elisabeth Wiede, Hacks’ Ehefrau.
Man macht auch Bekanntschaft mit »Onkel Paul«; so wird Hans Joachim Pavel zuweilen genannt, der Leiter des Drei-Masken-Verlags in München, der Hacks‘ Bühnenrechte im Westen vertrat. Diese Geheimniskrämerei hatte einen guten Grund, denn offensichtlich hat Hacks nicht alle Einkünfte in der Bundesrepublik dem für ihn zuständigen Finanzamt in der DDR gemeldet; und so konnte sich »Mamama« im Bedarfsfall jederzeit bei »Onkel Paul« mit Bargeld versorgen. Von dessen »Erbe« erwarb sie im Dezember 1962 »1 Kühlschrank 160 Liter (~ 850, –). 1 Trockenschleuder ›Sicco‹ (~ 225,–). 1 Fernseh-Truhe ›Club‹ (~ 1750,–). 1 Waschmaschine ›Flora‹ (~ 525,–). 1 Küchenmaschine ›Komet‹ (~ 250,–). 1 Hochantenne.« All diese Gerätschaften wurden von einer dänischen Firma nach Berlin in die Schönhauser Allee 129 transportiert, als Hacks und seine Frau dort eine geräumige Wohnung bezogen.
Andere Begleitumstände beim Geschäft des Dichtens werden ebenfalls in aller Ausführlichkeit geschildert, etwa die Schwierigkeiten mit den wechselnden Haushaltshilfen, die Suche nach einem angemessenen Landsitz für den Sommer oder die unermüdliche Jagd nach Antiquitäten. Obligatorischer Bestandteil der Briefe ist die Erörterung der meteorologischen Lage; Hacks litt unter niedrigem Blutdruck und Wetterfühligkeit, was seine Arbeitsfähigkeit mitunter stark beeinträchtigte.
Hacks machte oft keinen Hehl daraus, daß er mit seinen Aufzeichnungen aus dem Alltagsleben nur einer leidigen Pflicht genügte: »Das neue Farbband ist auch schon fast die größte von den Neuigkeiten.« Oder er schloß abrupt und demonstrativ erleichtert: »Seite Ende, Brief Schluß, Herzlichst Peter«. Manchmal versuchte er auch, sich der auferlegten Mitteilungspflicht zu entledigen, indem er einfach einbekannte: »Liebe Mamama, das ist doch wirklich kein würdiger Brief, der, um den Inhalt einer gewesenen Woche zu schildern, sich mit dem einzigen Satz begnügt: Es wird schon ein wenig wärmer. Aber in Wahrheit, das ist schon das Wesentliche.« Er kam dann aber doch noch ins Plaudern, so daß am Ende auch dieses Schreiben eine einzeilig mit Schreibmaschine gefüllte DIN-A4-Seite umfaßte. Ohnehin obsiegte in der Regel die für Hacks charakteristische Freude an einer guten Pointe. Wenn schon von nichts Wichtigem die Rede war, sollte es wenigstens witzig zugehen. Und so bereiten viele der überlieferten Episteln allen Einkaufslisten zum Trotz doch ein erhebliches Lesevergnügen.
Natürlich sind die Kommentare zur (Kultur-)Politik und zum Zeitgeschehen in den mehr als 450 Briefen, die Hacks bis zu ihrem Tod im Jahr 1972 an seine Mutter schickte, literaturhistorisch ungleich aufschlußreicher als die Auskünfte über Konsumbedürfnisse und gesundheitliche Befindlichkeiten. Die besondere Haltung des Briefeschreibers wird aber erst durch diese Melange deutlich, denn Nachrichten aus dem Kulturbetrieb werden auf die gleiche Art weitergegeben wie Erörterungen der Wetterlage: konstatierend und dekretierend. An nichts, so zeigt sich selbst in seiner privaten Korrespondenz, war Hacks weniger interessiert als an einem Austausch von »Ansichten«. Hatte er 1948 in einem Referat »Über den Stil in Thomas Manns ›Lotte in Weimar‹« für ein Seminar Artur Kutschers noch bestimmt: »Überlegenheit heißt Einsicht in Zwiespälte und gleichwertige Polaritäten« und Thomas Mann sogar wegen des »einsichtigen Verzichts auf wahre Erkenntnis« gelobt, so sind Hacks’ Briefe alles andere als Zeugnisse einer solchen Überlegenheit. Er nahm Standpunkte ein, verhandelbar waren sie für ihn nicht. Wechselte er einen Standpunkt, dann war eben ein Irrtum korrigiert und mehr darüber nicht zu sagen. Eine solche Korrektur vollzog er in der Einschätzung Wolf Biermanns, den er 1962 gegenüber seiner Mutter als »äußerst begabten Knaben« titulierte, vier Jahre später aber in der Zeitschrift »Theater heute« wegen der ihm bestenfalls als drollig erscheinenden Anwandlung, ständig die Regierung belehren zu wollen, als ostdeutsches Gegenstück zu Günter Grass verspottete. Sein Urteil über die Politik Gorbatschows revidierte er noch schneller: 1987 rühmte er ihn in einem Brief an seinen Bruder als »hochbegabten Schüler von Andropow«. Ein Jahr später verurteilte er ihn als »unbegabt«: »Wie Du richtig siehst, hatte ich ihm, solange er Andropowsche Meinungen vorbrachte, Vertrauen geschenkt. Leider hat er inzwischen eigene.«
Peter Hacks verübelte seinem Bruder, der Mitglied der FDP war, seine politischen Ansichten zutiefst. Auch sonst läßt sich ein Brüderpaar kaum gegensätzlicher denken: Jakob Hacks, der 1947 an der Technischen Hochschule in München mit der Arbeit »Über ein neues empfindliches Verfahren zum Aufsuchen von kleinen ferromagnetischen Körpern« promoviert wurde und bis 1951 als Ingenieur bei Telefunken, dann bei der Firma Rhode und Schwarz in München arbeitete, war zunächst begeisterter Tennis-, später Golfspieler; zusammen mit Gerd Hedler veröffentlichte er 1977 das Buch »Unser Kind spielt Tennis«. Peter Hacks dagegen, der kinderlos blieb, hatte schon 1943 als Schüler in Breslau jegliche Art von Sport verachtet. Er wurde 1943/44 wegen wiederholt ärztlich diagnostizierter Herzinsuffizienz und Anämie vom Turnunterreicht freigestellt und quittierte ausweislich der Erinnerungen seines damals engsten Freundes Hansgeorg Michaelis die von einem Mitschüler vorgebrachte Kritik an seiner mangelnden Muskelmasse mit dem Satz: »Ich habe geistige Muskeln.« Doch erst der politische Dissens machte den Gegensatz zwischen den Brüdern unüberbrückbar.
Es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, daß Peter Hacks die Entscheidung, in die DDR zu ziehen, jemals angezweifelt hat. In den Briefen an seine Mutter kommt vielmehr ein klares Lagerdenken zum Ausdruck: »wir in der DDR«, »ihr im Westen«. Daß sich viele seiner Hoffnungen nicht erfüllten und er unzufrieden mit der politischen Entwicklung in seinem Land war, besonders von 1971 an, als es von Erich Honecker regiert wurde (Hacks bezeichnet ihn in einem Brief an seinen Bruder voller Verachtung als den noch vor Hans-Dietrich Genscher »beliebtesten westdeutschen Politiker«), hat sein grundsätzliches Einverständnis mit dem Staat, in dem er sich zu leben entschlossen hatte, nie beeinträchtigt. Seine Unzufriedenheit der Familie gegenüber zu bekunden, verbot er sich, um nicht immer wieder erklären zu müssen, warum er der DDR dennoch die Treue hielt. In Dachau war man ohnehin weder gewillt noch in der Lage, dergleichen zu verstehen. Als die Mutter einmal glaubte, eine Packung Reis in eines ihrer Freßpakete packen zu müssen, antwortete ihr Hacks lakonisch: »Nun, man soll nicht klagen, andere Leute kriegen Mehl und Margarine geschickt.« Da er auf wenig bis gar kein Verständnis hoffte, verlor er der Mutter gegenüber so gut wie kein Wort über das Verbot seines Stücks »Die Sorgen und die Macht«. Über die beschämende Absetzung seines Mentors Wolfgang Langhoff als Intendant des Deutschen Theaters im Mai 1963 berichtete er ohne Anzeichen von Empörung. Selbst das kulturpolitische Desaster, zu dem das 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965 führte, brachte ihn erst aus der Ruhe, als auch sein Stück »Moritz Tassow« vom Spielplan gestrichen wurde.
Kurios nimmt sich aus, daß Anfang des gleichen Monats Friedrich Dieckmann Hacks besuchte und außer Manfred Bierwisch auch Uwe Johnson mitbrachte. Sechs Jahre zuvor hatte Hacks »diesen Uwe Johnson« noch scharf attackiert, ihm vorgeworfen, er dehne »sein Nichtwissen von der Gesellschaft aus auf die Welt und erachte sie, bestens unterstützt von allen reaktionären Ideologen, für nicht erkennbar«. Und nun saß »dieser Uwe Johnson«, als ob nie etwas gewesen wäre, friedlich im biedermeierlich-opulent ausstaffierten Wohnzimmer von Hacks, der sich darüber nicht weiter verwundert zeigte, sondern sich nur maßlos ennuyierte.
Hacks buhlte nicht im geringsten um die Zuneigung der Mit- und Nachwelt. Daß er nach ihrem Tod in einem Telegramm um nichts anderes als die Sicherung seiner Briefe an »Mamama« bat, dürfte kaum geeignet sein, seine Sympathiewerte beim Durchschnittsleser steigen zu lassen. Was man als Allüre und Eitelkeit anprangern kann (und sicher tun wird), birgt indes einen Vorzug, den man nicht unterschätzen sollte: Hacks hat sich weder im Privaten noch im Politischen und schon gar nicht im Ästhetischen jemals opportunistisch verhalten. Seiner Irrtümer schämte er sich nicht und sah auch sonst keinen Anlaß, Dokumente seines Lebens der Nachwelt vorzuenthalten. Seinem Verleger Matthias Oehme ließ er freie Hand, alles, was diesem einfalle, aus dem Nachlaß zu veröffentlichen. Im Jahr 2000 schenkte er sogar, ohne über eine Kopie zu verfügen, dem Deutschen Literaturarchiv Marbach seine Akte aus dem Ministerium für Staatssicherheit. Die diese Akte verwaltende Behörde gab sie allerdings nicht heraus, was Hacks fragen ließ, mit welchem Recht man sich zwischen ihn und sein Publikum dränge.
Obwohl sein Nachlaß ihn als umsichtigen und sorgfältigen Archivar zeigt, hat er nur zwei Briefe und eine Postkarte seiner Mutter aufbewahrt. Das widerspricht nicht dem Befund einer rückhaltlosen Offenheit gegenüber der Nachwelt, denn Biographisches hielt Hacks im Hinblick auf die literarische Leistung eines Dichters für völlig belanglos. Das mag erstaunen, hat er in seinem erfolgreichsten Theaterstück »Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe« doch Intimstes aus dem Privatleben des Klassikers verwandt. Tatsächlich interessierten ihn an diesem Stoff jedoch nicht die Initimitäten, sondern die Möglichkeit, das prekäre Verhältnis von Genie und Gesellschaft dramatisch darstellen und das Formproblem des Monodramas auf eine ästhetisch befriedigende Weise lösen zu können.
Hacks’ entschiedene Sonderung von Wichtigem und Unwichtigem bei der Selbstarchivierung seines Lebens bringt mit sich, daß die – neben der Korrespondenz mit dem Jugendfreund Hansgeorg Michaelis – wichtigste biographische Quelle ebenso ein Monolog bleibt wie sein Drama über Charlotte von Stein und Goethe. Die Stimme der Mutter, ihre Sorgen, Nöte, kulturellen Interessen (die ausgeprägt waren) erschließen sich allenfalls mittelbar. Von ihr kennen wir nur ein paar Lebensdaten, wissen, daß sie mit dem Juristen und Sozialisten Karl Hacks verheiratet war und sich (das berichtet der Historiker Fritz Stern in seinen Erinnerungen) in Breslau für die Montessori-Schule engagiert hat. Mehr wissen wir nicht.
Am Ende dokumentiert die Art und Weise der Überlieferung seiner Familienbriefe genauso wie Hacks’ wiederholte Beteuerung, es sei doch gar nichts Berichtenswertes vorgefallen, daß in seinen Augen Lebensgewohnheiten von Dichtern nichts zum Verständnis von Dichtkunst beitragen. Die Briefe an seine Mutter sind mithin auch eine Mahnung an künftige Biographen, sich tunlichst mit dem einzig Wesentlichen in seinem Leben zu befassen: seinen Werken.
SINN UND FORM 3/2012, S. 293-297.