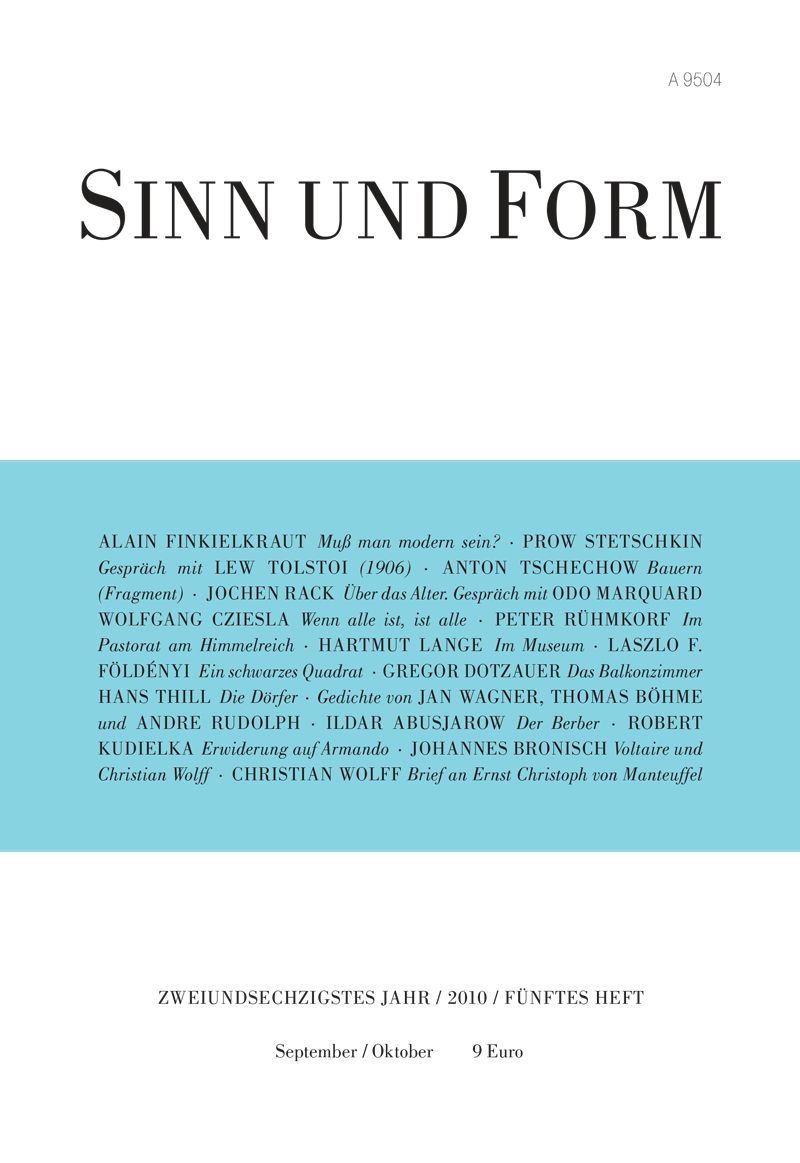Leseprobe aus Heft 5/2010
Rühmkorf, Peter
Im Pastorat am Himmelreich. Rede zum Johann-Heinrich-Voß-Preis
Als ich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts meinen 70.Geburtstag feierte, fand sich unter zahlreichen ausgesucht persönlichen Geschenken ein besonders merkwürdiges und beziehungsreiches. Es stammte von meiner Cousine Margret, die mir zum Anlaß Johann Heinrich Voß’ Idylle »Der siebzigste Geburtstag« aus einer alten Werkausgabe herauskopiert hatte und mit eigener Hand gebunden und mit teils stattlichen, teils komischen Greisenporträts versehen, und natürlich begann ich sofort darin zu lesen. Alles noch ohne Hinblick oder Bezug auf den mir hier verliehenen Preis, denn davon konnte noch niemand nichts wissen, aber wohl im erinnerungsseligen Rückblick auf gewisse Bildungstraditionen im Hause Rühmkorf, die sich nicht ganz von ungefähr mit der Stadt Otterndorf verbinden. Zwar stand hier nicht gerade mein Vaterhaus. Ein solches im eigentlichen Sinne gab es für mich nicht, aber im Pastorat am Himmelreich residierte doch immerhin mein Großvater, der Herr Supperndent, wie er im Volksmund hieß, eine patriarchalische Gestalt, die ich in Ermanglung einer greifbaren Vaterfigur bis zu meinem 9. oder 10. Lebensjahr Vati nannte.
Das erscheint mir heute noch seltsam und setzt bei Ihnen ein gewisses biografisches Vorwissen voraus, das ich freilich nicht jedem Feiertagsgast in Ihren Reihen abverlangen kann. Mein wirklicher, heißt mein leiblicher Vater war nämlich ein reisender Puppenspieler gewesen, an dem meine Mutter ein etwas aus der Art geschlagenes Gefallen gefunden hatte, immerhin ein derart konkretes, daß aus der flüchtigen Verbindung ein sogenannter natürlicher Sohn hervorging, was schon insofern nicht verschwiegen werden kann, als er heute – selbst bereits in großväterlichem Alter – vor Ihnen steht. Ich habe über meine ein wenig aus der bürgerlichen Tugendnorm weichende Herkunft schon öfter berichtet, zunächst in dem Memobuch »Die Jahre, die Ihr kennt« und gerade kürzlich noch in einem gereimten Capriccio, das folgendermaßen beginnt:
Als meiner Mutter mein Vater
zu gefallen begann,
fing bereits das Affentheater
meiner eigenen Fleischwerdung an.
Nun haben Gedichte allerdings so ihren eigenen schillernden Aussagewert – »Die Kunst ist immer ein Gemisch / aus teils authent-, teils trügerisch« –, daß ich Sie, der Verständlichkeit halber, lieber in unterrichtender Prosa mit dem Fall bekanntmachen möchte, der ja in Anbetracht der Verhältnisse auch als Sündenfall zu betrachten war, denn wo eine Pastorentochter und Religionslehrerin sich auf etwas so Zweifelhaftes wie einen (verheirateten) Poppenspeeler einläßt, ist mit häuslichen Glückwunschadressen zunächst nicht zu rechnen. In der Tat begann dann auch vor der unvermeidlichen Beichte zunächst ein etwas seltsames Vexierspiel, das nicht nur komische Züge verzeichnet. Da meine Mutter auch weiter ihr Vaterhaus besuchte, versuchte sie zunächst den Vorfall zu vertuschen, zu camouflieren, zu ummänteln, alles in der fürchterlichen Erwartung eines superintendentalen Mordsdonnerwetters mit anschließender Verstoßung aus dem Familienkreise. Bis die heilige Offenbarungsangst sie nach all den Kostümierungsversuchen schließlich auf spirituelle und insofern erbaulichere Mittel verfallen ließ, und die trage ich Ihnen nun richtig gerne vor. Als u. a. Religionslehrerin – ich sagte es schon – hatte sie sich schon seit längerem mit den Schriften Karl Barths bekanntgemacht, also insofern der allermodernsten, heißt der dialektischen Theologie, und als sie sich aus ihrer Sündennot keinen Ausweg mehr wußte, wandte sie sich in einer Anwandlung von sozusagen naturwüchsiger Dialektik an den berühmten Theologen, ihn um die Patenschaft für das Unglücksbündel zu bitten.Um es kurz zu machen, denn wir wollen hier ja nicht auf eine Betrachtung von Barths revolutionären Interpretationen des Römerbriefes hinaus, sondern auf die Voßschen Idyllen: diese schützende Patenhand vermochte es dann tatsächlich, die Schatten des libertinären Makels zu verscheuchen und meinen doch recht konservativ gesonnenen Großvater gnädig zu stimmen. Meine Großmutter Helene, eine geborene Hübbe, war ohnehin ein ständig fließender Brunnen der Mildsinnigkeit und Verzeihlichkeit, und so geschah es, daß aus dem befürchteten Familiendrama schließlich ein richtiges Idyll erwuchs, in dem mein Großvater selbst die Bezeichnung »Vati« als ein einschmeichelndes Zauberwort empfand. Immerhin war ich sein einziger Enkel und durch den unliebsamen Zufall sogar ein potentieller Fortsetzer des Geschlechtes und Bewahrer des guten Familiennamens. Zwei Söhne waren im Studentenalter im ersten Weltkrieg gefallen. Die jüngste Tochter Emmi an der Schwindsucht gestorben. Meine Tante Klara – ihr Leben lang nur Lala genannt – hatte ebenfalls mit tuberkulösen Beschwerden zu tun gehabt und sich bereits mit dem Schicksal einer ewigen Haustochter abgefunden, eine betrübliche Aussicht, die erst sehr viel später eine glückliche Wendung nahm. Praktisch also, was blieb ihm, als sich gottesfürchtig mit den Umständen abzufinden und die ihm verbliebenen ungleichen Fünfe gerade sein zu lassen.
Von Statur und Gesichtsschnitt her, ja selbst vom Haarschnitt, war mein Großvater eine in jeder Hinsicht stattliche Erscheinung, sozusagen ein schöner Mann und ein Patriarch in seinem kleinen Kreise, obwohl seine Töchter schon gelegentlich äußerten: »Wenn unser Vater doch so interessant predigen würde wie er aussieht.« Immerhin war er ein milder Regent, etwas unpraktisch vielleicht, was ihn dann auch wieder gängelbar machte und einer Familienharmonie Vorschub leistete, die einer vossischen Idylle schon ziemlich nahe kam. Nun war Johann Heinrich Voß allerdings kein unbekannter Name in meinem Großvaterhaus und seine Homerübersetzungen gehörten ebenso zum allgemeinen Bildungsbesitz wie seine genrehaften Familienutopien. »Luise Voß und Dorothee Goete / schön beide wie die Morgenröte«, das war ein geflügeltes Wort des neunzehnten Jahrhunderts gewesen, und die beiden Schwestern Klara und Elisabeth trugen es mir bereits in einem Alter zu, als ich noch gar nicht lesen konnte. Ich selbst fand die »Luise« später sterbenslangweilig und der »Siebzigste Geburtstag« schien mir eher ein unfreiwilliges Lachprodukt, eine Meinung, die ich heute nicht mehr so unbedingt teile, denn die liebevolle Ausmalung eines wohlgeordneten und überschaubaren Gesellschaftsausschnittes scheint mir doch einer wohlwollenden Betrachtung wert. Die Frage ist ja immer, was man wirklich will und was es sonst so auf der Welt gibt. Strindbergsche Ehe- und Familienkatastrophen mögen interessanter sein – auf das eigene Leben übertragen, legen sie dann doch gewisse Bedenklichkeiten nahe. Tschechows und Schnitzlers Dramen mögen uns näher liegen und uns tiefer an die Nerven gehen, von Beckett oder Hans Henny Jahnn ganz zu schweigen – aber als idealische Muster für ein glücklich absolviertes Curriculum sind sie doch kaum zu betrachten. Daß das fast schon spießerhafte, philiströse Gedanken sind, weiß ich selbst. Sie sind nichtsdestoweniger radikal und betreffen auch den Sinn von Literatur an einer besonders wunden Stelle: Soll sie nun wirklich ihre Leser, Zuschauer oder Hörer ausweglos der Verzweiflung überantworten oder ihnen nicht wenigstens einen erbaulichen Hoffnungsprospekt vor Augen malen, es muß ja nicht unbedingt eine im bloßen Restaurationsmief gefaßte Pfarrhausinnerlichkeit sein.
Den unterschiedlichsten Bewertungen sind die Voßschen Idyllen schon immer unterworfen gewesen. Einerseits sah man sehr wohl, daß neuerwachter Bürgerstolz und bürgerliches Tugendbewußtsein sich als eigene Ideale gegenüber unberechenbarer Fürstenwillkür zu behaupten suchten. Andererseits, na ja, hielten sich diese harmoniebetonten Genrebilder doch auch wieder recht selbstgenügsam im Rahmen und versuchten gar nicht erst, an den feudal verfügten Festen der Welt zu rütteln. Eine Bescheidungsideologie. Aus eingeborenem Harmoniebedürfnis und als gelernter Meliorist möchte ich allerdings meinen, daß wohl beides seine Richtigkeit hat. Vor allem aber, daß eine in wirkliche Lebenspraxis übersetzte Utopie nicht unbedingt zu verachten ist, und wer solche idealischen Zustände einmal mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Sinnen erlebt hat, denkt über ausgeglichene Weltverhältnisse im Kleinen nicht mehr ganz so kritisch.
[...]
SINN UND FORM 5/2010, S. 623-634