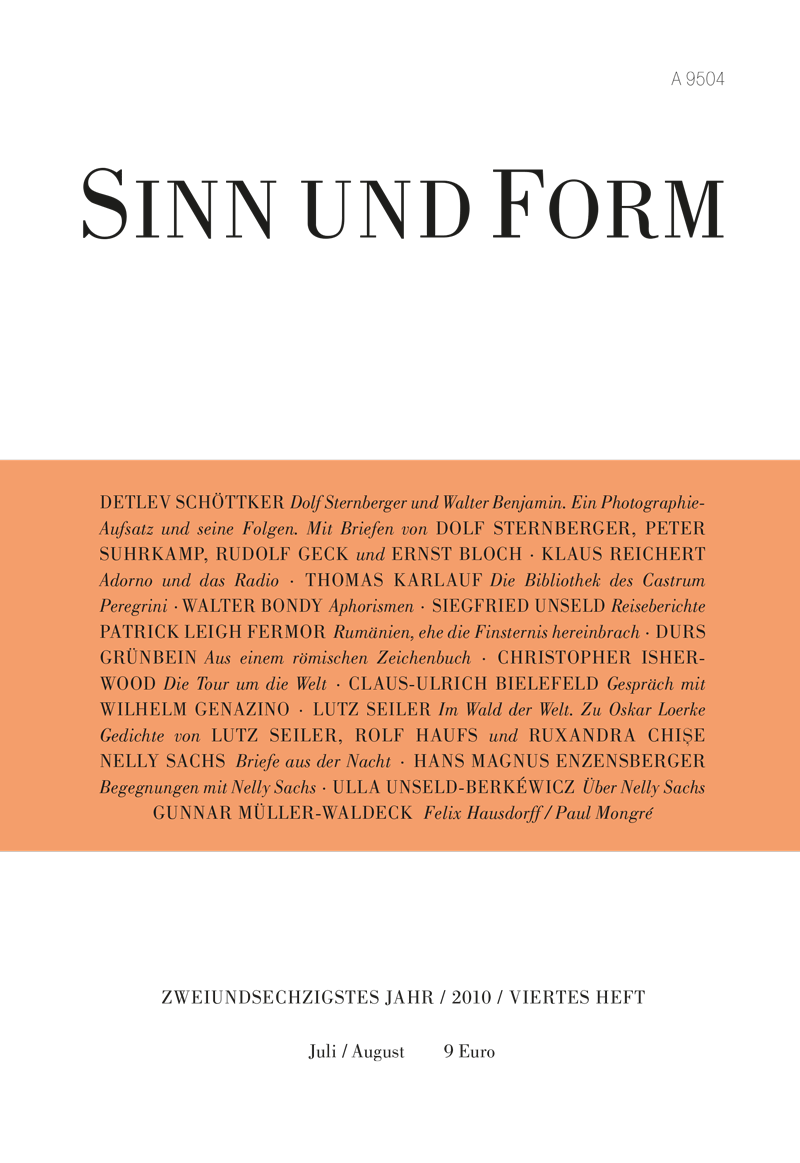Leseprobe aus Heft 4/2010
Genazino, Wilhelm
Gespräch mit Wilhelm Genazino
CLAUS-ULRICH BIELEFELD: In Ihrem Roman »Das Glück in glücksfernen Zeiten« erzählen Sie aus dem Leben des 41jährigen Gerhard Warlich. Der hat über Heidegger promoviert, arbeitet aber als Geschäftsführer einer Großwäscherei. Und er verspürt den Drang, seine Mitmenschen manchmal »über die allgemeine Ödnis des Wirklichen« aufzuklären. Die Ödnis des Wirklichen, ist das der Stachel, der im Fleische Gerhard Warlichs steckt und auch in dem Ihrer anderen Helden?
WILHELM GENAZINO: Das kann man so sagen. Die Ödnis des Wirklichen ist nicht nur der innerste Kern dessen, was meine Protagonisten sehen, sondern auch dessen, was ich sehe, worüber ich mich nicht beruhigen kann.
BIELEFELD: Ihre Helden leiden ja einerseits an dem öden Alltag, in dem sie gefangen sind, andererseits suchen sie ständig nach kleinen Sensationen, die sie in winzigsten Dingen finden. Gerhard Warlich sitzt zum Beispiel am Anfang des Romans in einem Straßencafé, und durch intensives Schauen öffnet sich ihm dort die Welt.
GENAZINO: Das ist sozusagen der Notausgang für ihn, das Schauen, seine Fähigkeit, kleine oder mittlere Ereignisse zu sehen, die ihn unterhalten, ihn auf eine andere Ebene heben, in eine andere Wirklichkeit bringen. Das ist der metaphysische Trick, daß man, wenn man sich anstrengt und einige Kniffe kennt, dem »Zwangsabonnement der Wirklichkeit« entkommt.
BIELEFELD: Dieses Entdecken der Wirklichkeit durch Blicke, durch das plötzliche Aufblitzen von Situationen, gewissermaßen kleiner Epiphanien, das ist auch eine Art unbewußte Widerstandshaltung gegen die schnöde Wirklichkeit.
GENAZINO: Gerhard Warlich hat durchaus bemerkt, daß diese anfangs unbewußte Möglichkeit inzwischen in eine bewußte übergegangen ist. Wenn er innerlich in Not ist, setzt er sich hin und sagt: Ich weiß, was mir helfen könnte, und dann sucht er und findet bald auch etwas.
BIELEFELD: Aber irgendwann geht es nicht mehr. Er endet in einer psychiatrischen Klinik, weil die Zumutungen zu groß geworden sind. Selbst seine Lebensgefährtin Traudel sagt plötzlich, ach, wir sollten heiraten und ein Kind haben, mit meinen 38 Jahren wäre das vielleicht genau das Richtige. Das macht ihn völlig fertig, um es mal salopp zu sagen.
GENAZINO: Er glaubt, das würde sein Existenzkalkül durcheinanderbringen. Und er fürchtet, daß das ganze Arrangement damit kippt und er der Verlierer dieser Veränderung sein wird. Ihm fehlt einfach der Mut, sein Leben zu transformieren.
BIELEFELD: Er selbst nennt sich einmal einen Hysteriker des Ichs. Warum kommt er nicht aus dieser Situation heraus?
GENAZINO: Wenn ich das wüßte, würde ich wahrscheinlich keine Romane mehr schreiben. Man kommt ja selten hinter die Maskerade der Worte. Mal kommt der eine Begriff der Sache näher und mal der andere, aber was im Erfahrungskern dieses Problems eigentlich steckt, entzieht sich uns beziehungsweise ist nicht faßbar.
BIELEFELD: Sie haben am Anfang eine leise Andeutung gemacht, daß die Figuren und Sie selbst gewisse Ähnlichkeiten haben. Welche sind das?
GENAZINO: Da gibt es einige. Zum Beispiel mache auch ich vom Umhergehen und Schauen und Transformieren reichlich Gebrauch. Das ist immer unterhaltsam. Im Gegensatz zu den öffentlichen Unterhaltern, dem Fernsehen.Wenn man das satt hat, braucht man eine Alternative. Dann muß man sozusagen vom Fernsehen umschalten aufs Nahsehen. Oder aufs ichhafte Sehen. Das ist ein wunderbares Unterhaltungsprogramm, weil es mit dem Sehenden selbst zu tun hat.
BIELEFELD: Sie gelten als der große Flaneur der deutschen Literatur. Wie geht dieses Flanieren vor sich? Sie brauchen dafür ja eine Stadt, am besten wahrscheinlich Frankfurt am Main?
GENAZINO: Ich mache das auch anderswo. Und man benötigt dafür auch keine besondere Gebrauchsanweisung, sondern man geht einfach los, möglichst absichtslos, in möglichst öden Umgebungen – also keineswegs dort, wo es nach allgemeiner Auffassung besonders interessant ist oder wo es von Sehenswürdigkeiten wimmelt. Sondern dorthin, wo es eigentlich nichts gibt. Das ist gerade das Interessante, denn die Langeweile, die sich dort ausbreitet, ist gar keine. Nach Walter Benjamin ist die Langeweile nur ein samtenes Etui, das wunderbare Schätze birgt. Sie enthüllen sich einem, wenn man länger hinschaut als üblich.
BIELEFELD: Und das machen Sie?
GENAZINO: Das mache ich. Und auch wenn es sehr lange dauert, stört mich das nicht. Selbst wenn das Ergebnis nach allgemeiner Übereinkunft öde ist, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was man in der Nachbereitung daraus macht. Das, was einem Menschen auffällt, hat immer einen Bezug zu seiner Innenwelt, seiner Biographie. Sonst würde es ihm nicht auffallen. Und diesen Bezug zu entdecken, darum geht es. Warum fällt mir zum Beispiel ein lahmer Hund auf? Warum bemerke ich einen Hund, dessen eines Hinterbein verbunden ist und der herumhumpelt? Diese Verletzung macht ihn mensch- licher, als er ohnehin schon ist. Warum ist das so? Warum springe ich darauf an? Wenn ich eine Weile nachdenke, mich eine Weile in mich selber einfühle, fällt mir natürlich der Bezug ein, der Bezug zu mir selbst. Das ist eine Technik, die ich jedem Menschen empfehle. Das hat mit Literatur zunächst gar nichts zu tun. Es ist einfach eine wunderbare Lebensartgestaltung. Man muß natürlich etwas Geduld haben, man muß auch den Mut haben, sich von allen öffentlichen und allen anderen uns beherrschenden Unterhaltungssitten zu trennen.
BIELEFELD: Sie beschreiben hier ein großes Augenglück, ein Glück, das bei der heutigen Überflutung mit Bildern schwer zu ergattern ist.
GENAZINO: Ja, das ist schwer und es wird immer schwerer, weil die Einkesselung, in der wir stecken, immer massiver wird. Man kann ja noch nicht einmal mehr auf den Boden gucken, denn in den Städten ist inzwischen auch der Boden mit Reklame bepflastert. Das ist ungeheuerlich. Mich wundert, daß das nicht thematisiert wird, daß sich niemand darüber aufregt. Früher hatte man eine erste Fluchtmöglichkeit, indem man mit gesenktem Blick umherging. Das kann man heute nicht mehr. Und auch in den Himmel kann man nur noch schauen, wenn man in einem Park oder einem Schwimmbad ist.
[...]
SINN UND FORM 4/2010, S. 518-523