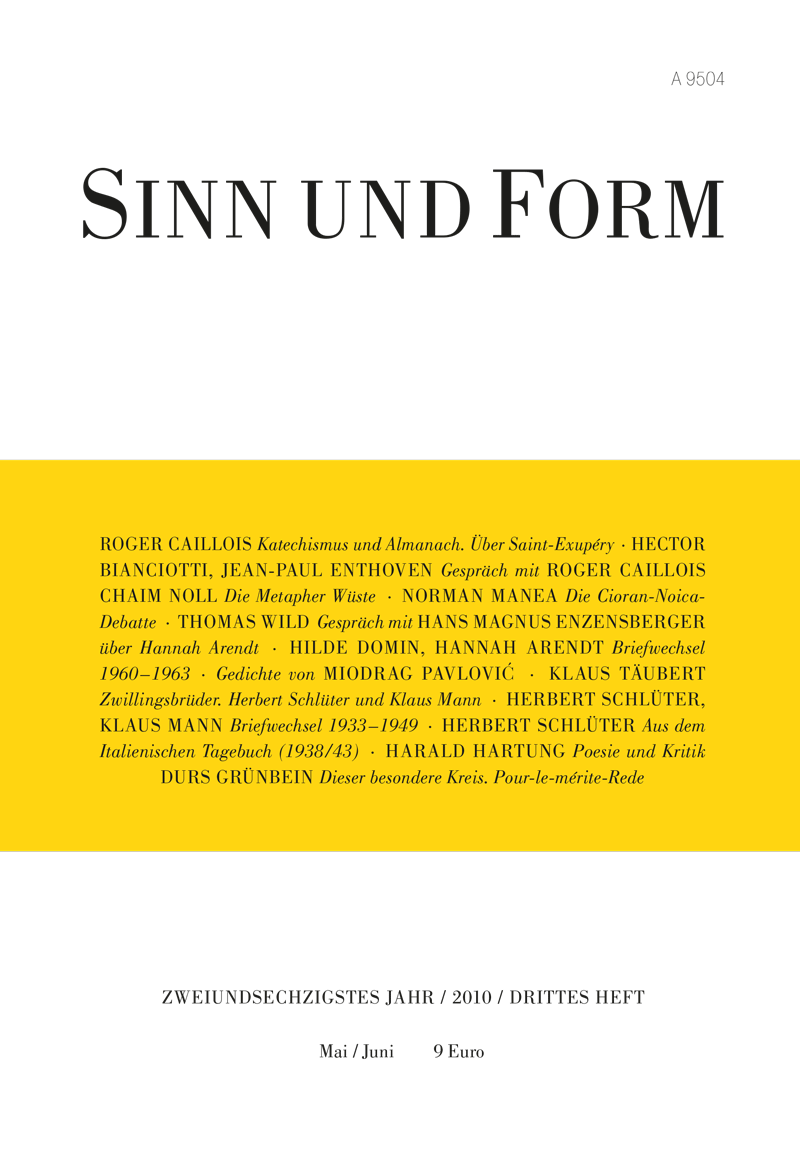Leseprobe aus Heft 3/2010
Caillois, Roger
Katechismus und Almanach. Über Saint-Exupéry
Als Kind hatte Saint-Exupéry offenbar eine fast religiöse Ehrfurcht vor dem Schriftstellerberuf, die er auch nie verlor. Für Kinder und schlichte Gemüter ist Gedrucktes dasselbe wie Literatur. Es hat für sie ein Prestige, das sie später als unverdient ansehen müssen. In Inneraustralien leben Stämme, bei denen die – rein negative – Initiation darin besteht, daß den Jungen erklärt wird, es gebe weder Götter noch Geister, die seltsamen Geräusche, die sie erschreckten, könnten auch sie, zum Schrecken anderer, erzeugen, mit Instrumenten, die sie bekämen, die furchteinflößenden weißen Spukgestalten könnten auch sie beliebig herbeizitieren, indem sie sich mit Farbe bemalten, die sie bekämen, und Masken trügen, die sie selbst schnitzten. Strehlow, der die brutalen und im wahrsten Sinne des Wortes vernichtenden Initiationsreden wörtlich überliefert, schreibt, soweit ich weiß, nichts über die Gefühle der jungen Loritja (oder Aranda?), die zum Ausgleich für dieses plötzliche Vakuum die Macht erhalten, andere zu ängstigen, die ebenso naiv sind wie sie selbst noch einen Tag zuvor. Ich für mein Teil sehe fast keinen schlimmeren Grund zu verzweifeln: Das mit Furcht und Zittern Respektierte bricht zusammen, doch der Zusammenbruch führt zu einem entscheidenden Aufstieg. Man erklärt dem Novizen, daß man ihn getäuscht hat, und entschädigt ihn für dieses Wissen mit der allgemein anerkannten Befugnis, andere zu täuschen. Dieser Handel ist keine Besonderheit der inneraustralischen Savanne. In den Hauptstädten der zivilisierten Welt offeriert man dergleichen, wiewohl entschärft und abgemildert, dem angehenden Diplomaten, dem Jungmanager, dem Studienanfänger, jedem, der sich anschickt, die bedeutsame Schwelle zu überschreiten. Er blickt ins Nichts, aber erhält dafür einen kleinen Anteil an der Macht: einer Macht, die bei den Wilden auf unverhohlenem Betrug beruht, in den Gremien moderner Gesellschaften darauf, daß man die Aufgabe und die Schwierigkeiten, sie zu erfüllen, auf feine, aber unklare und kaum faßbare, doch letztlich beeindruckende Weise mystifiziert. Diese Mystifikation geht einher mit Geheimniskrämerei hinsichtlich der mit der Aufgabe verbundenen Privilegien. Solche Praktiken sind zwar schwerer zu durchschauen als Masken oder Farben, aber ebenso verlogen.
Nicht anders ergeht es dem literaturgläubigen jungen Menschen, wenn er selbst Schriftsteller wird. Bis dahin hatte er vor Büchern denselben Respekt wie vor Priestern oder Lehrern. Für Kinder, vor allem auf dem Lande, sind Bücher etwas Besonderes und fast immer von gleicher Art. Die ganze Literatur scheint ihnen verwandt mit Büchern, die sie kennen und die ihnen die Welt aufschließen, die Erfahrung der Erwachsenen vermitteln und ihnen ihre Pflichten dartun. Sie sind, wie das Abc-Buch und der Kalender, ohne Wenn und Aber gültig und auch ein bißchen magisch. Sie überbringen Gesetze, Wissen und Macht. Das gilt nicht nur für Lehrbücher. Eine unerschöpfliche Fundgrube ist der Almanach: er enthält tausend praktische Anleitungen, Bildtafeln von Saaten, Äckern, Ernten, verschiedenen Knoten, unterhaltsame Einblicke in die Physik, Porträts und Lebensläufe ausländischer Staatsoberhäupter, die wöchentlichen Himmelskarten, mit weißen Sternen in kleinen schwarzen Quadraten oben und unten auf der Seite, alle möglichen wertvollen, nützlichen oder ausgefallenen Kenntnisse, die für anhaltende Freude sorgen; eine offene Tür ins wirkliche Leben, in die unermeßliche Welt. Dazu kommt der Katechismus, durch den das Kind Glaubensartikel und Gebote lernt, formelhafte Texte, an denen auch nur ein Wort zu ändern Sünde wäre.
Ein Schriftsteller, der von Kind an diese abergläubische Ehrfurcht vor Gedrucktem erlebt oder empfunden hat, wird sie nicht ohne weiteres ablegen. Vielleicht hat gerade diese Gläubigkeit ihm Lust gemacht, Schriftsteller zu werden. Man müßte untersuchen, wie er die Realität der Literatur allmählich anerkennt und in welchem Moment der von der Hexenkunst Entzückte das Handwerk zu lernen beginnt.
Gewiß ist er oft deprimiert, wenn nicht empört, über die unglaubliche Leichtfertigkeit der Älteren, ihre Gewissenlosigkeit, ihre Erfolgssucht, ihre erbärmliche Eitelkeit. Doch bald entdeckt er voller Scham, daß sich auch bei ihm Fehler einschleichen und verfestigen, die ihn bei anderen stören. Die Gewohnheit tut das ihre, die Scham vergeht und mit ihr die Erinnerung an das einstige Feuer. Schreiben wird zum Beruf oder zum Karrieremittel. Es geht nur noch um Publizität und Auflagen, um Geld und Ehren; und bei einigen, nicht unbedingt den Lautersten, um den Beifall eines kleinen Kreises oder um den Ruf der Lauterkeit. Dies alles blieb Saint-Exupéry erspart. Er hat sich dem entzogen, und vermutlich hat ihm der Verzicht auch gar nichts ausgemacht. Womöglich ist er dem Almanach und dem Katechismus ganz selbstverständlich treu geblieben, obwohl er Katechismen verabscheute und vielleicht nie in einem Almanach geblättert hat. Doch ich spreche vom Gehalt und der Glaubwürdigkeit der Texte und von der Welt der Kindheit und der Dörfer, in der Katechismus und Almanach zwar nicht die einzigen, aber die wichtigsten Bücher waren (in Saint-Exupérys Kindheit). Mit ihnen erkundet das Kind das Heilige und das Weltliche, das Verborgene und das Sichtbare. Es entdeckt den Katalog und die manchmal überraschende (aber das ahnt es nicht) Hierarchie der Tugenden (Hoffnung) und Sünden (Schadenfreude); das System von Glaubenssätzen und Riten; die schlichten Worte der wesentlichen Mysterien; im weltlichen Bereich erlernt es den Zyklus der Jahreszeiten und der bäuerlichen Arbeiten, den Lauf der Sterne am Nachthimmel und ihre Deutung und natürlich auch Basteln, Zauberkunststücke und Knobeleien.
Meist bleibt von diesem frühen zusammengewürfelten Lehrstoff nicht viel hängen. Das Kind verliert den Glauben oder zumindest das Interesse an Offenbarungen und Mysterien. Der Erwachsene wählt einen Beruf, der Fachkenntnisse erfordert und ihn von dem bildhaften und rein zweckmäßigen, oberflächlichen Allgemeinwissen abbringt, das er im Almanach suchte. Saint-Exupéry überträgt und verlängert offenbar mehr als andere diese komplementären Bildungsgüter Katechismus und Almanach ins Erwachsenenleben und baut darauf auf: Er wird Pilot; er kann in stummer Nacht die Sprache der Sterne entziffern; er repariert Motoren, arbeitet an der Verbesserung eines Querruders, eines Landesystems, eines Geräts zur Aufzeichnung von Funkpeilungen, erwirbt Patente, stellt komplizierte Gleichungen auf, schreibt seitenweise Zahlen auf, um rein theoretische Probleme zu lösen, erfindet Kartentricks. Nebenbei verfaßt er moralische Traktate. In dieses Genre gehören alle seine Bücher, wie unterschiedlich sie auch sind: »Nachtflug«, »Die Stadt in der Wüste«, »Der Kleine Prinz«, »Wind, Sand und Sterne«, und erst recht das »Bekenntnis einer Freundschaft« oder die »Carnets«, in denen selbst bei den moralfernsten Themen der Moralist zum Vorschein kommt.
Was ich sagen will: Saint- Exupéry ist nicht zuerst ein Mann des Wortes, das zeigt schon seine Literaturauffassung. Er ist ein Mann der Tat, dem die Tat nicht genügt, weil er weiß, daß sie allein noch nichts besagt; ein Techniker, der nicht nur an den Nutzen der Technik denkt, sondern auch an ihre Gefahren; ein Kämpfer, der sich weder auf Mut noch auf Gehorsam verlassen will. Aber ein Mann der Feder ist er nicht: Sein Beruf zwingt ihn zu Sorgfalt, Härte und Umsicht; er muß sich mit seiner ganzen Person einsetzen, nicht nur mit Worten.
Die täglichen Pflichten schärfen sein Verantwortungsbewußtsein, bei anderen Autoren verkümmert es als erstes, wenn es nicht gebraucht wird. Er erlebt jeden Tag aufs neue, welche Folgen es haben kann, wenn man ein Ruder oder Funkgerät nicht überprüft oder wenn ein Maure glaubt, man sei feige oder illoyal, oder ein Untergebener, man nehme es nicht so genau, oder ein Kamerad, man denke mehr an sich als an die Mannschaft. Er erobert, er gestaltet eine neue, noch ungefestigte Zivilisationssphäre, in der das kleinste Versäumnis sich sofort auswirkt.
Für Saint-Exupéry ist die Literatur ein Zivilisationsmittel. Sie verhindert, daß Ängste und Großtaten, Niederlagen und Triumphe im Nichts verschwinden. Dergestalt erlangen sie gleichsam etwas Physisches, Strahlendes, Vorbildhaftes. Dieses ergänzt die Lehren, die man selber ziehen kann. Die Kunst des Schriftstellers macht sie zu einer einzigartigen Sentenz, einem wertvollen Kommentar, einer fruchtbaren Glosse in jenem unsichtbaren und riesigen Register, das die Erfahrungen einer Kultur enthält. Der Almanach lebt von bedeutsamen Anekdoten und bewährten Maximen, die den Katechismus ebenso prägen wie die alten chinesischen Klassiker und Geschichtsbücher. Saint-Exupéry versucht nie, den Gebildeten mit Hieroglyphen zu imponieren. Er beteiligt sich auch nicht an den Absonderlichkeiten und dem Geschwätz, den tausend Raffinessen, die nur dem Freude machen, der den ganzen Tag darüber nachsinnt, wie man Kollegen dazu bringt, eine Kunst zu bewundern, die sich ihrer selbst entfremdet hat.
Saint-Exupéry hat einen anderen, einen gefährlichen und schwierigen Beruf, der Können, Beharrlichkeit und Mut verlangt. Er arbeitet und kämpft. Am meisten Kraft kostet ihn sein Leben, nicht seine Kunst. In dieser Situation verzichtet er auf das Privileg des Dichters und Romanciers, das freie Erfinden, das man von ihm doch geradezu verlangt. Er weiß, daß in der Kunst Glaubwürdigkeit kein Verdienst ist, Aufrichtigkeit erst recht nicht, und daß man beide fingieren muß; eine Sache der Geschicklichkeit und nicht der Ehrlichkeit. Er kann nicht übersehen – er hat Beispiele vor Augen –, daß, wenn der Erzähler, ob nun Opfer oder Held, nicht sonderlich geschickt ist, die schlimmsten Prüfungen, die kühnsten Taten, die leidvollsten Triumphe stumm und leblos sind, ja gleichsam schlappe, langweilige Lügen; andererseits hat er so manches Meisterwerk gelesen von Menschen ohne Mut und Ethos, die nie gelitten, nichts erlebt und nichts gewagt haben, doch dank ihrer Phantasie bei Gewährsleuten oder in den Werken anderer fündig wurden, als ersetze ihnen die Schöpferkraft die Fähigkeit zu handeln, ja zu fühlen. Für ihre Freunde waren sie unscheinbar und mittelmäßig, und doch gaben sie einer erfundenen Geschichte Farbe, Glanz, Dichte und Klarheit. Darin besteht die grundlegende Ungerechtigkeit, die Eigengesetzlichkeit der Literatur, die wie das Dogma der Reversibilität ist.
Saint-Exupéry kennt sie. Doch er will dieses große Privileg nicht in Anspruch nehmen. Gewiß, er hat Talent und nutzt es, er arbeitet an seinem Stil, der nicht frei ist von gesuchten Begriffen und auch nicht von Rhetorik. Er hat eine besondere Gabe für starke und neue dichterische Bilder: Er verschmäht auch nicht die wunderbaren Wirkungen, die seine nüchterne, konkrete Prosa urplötzlich überstrahlen. Aber daß er solche im engeren Sinne literarischen Talente nutzt, ändert nichts an seinem eigentlichen Ehrgeiz. Für ihn sind sie bloß Werkzeuge, die ihm zur Verfügung stehen und die er bestmöglich nutzen will, weil ein kraftvoller, packender Stil seinem Anliegen mehr Leser verschafft. Das Wichtigste bleibt indes dieses Anliegen.
Er weiß sehr wohl, daß hier andere Regeln gelten, daß Begabung das Wesentliche ist und es besser ist, sie zu fördern, als für ein festes Fundament zu sorgen. Dennoch versagt er sich jedes Ausschmücken und Fabulieren und begibt sich damit der meisten Mittel, die für Schriftsteller so selbstverständlich sind, daß ihre Kunst zunichte würde, wenn man sie ihnen verböte und bloß Gedanken zuließe. Saint-Exupéry dagegen, dieser einzige oder fast einzige seiner Art, schreibt, um seine Aktivitäten zu dokumentieren. Seine Werke sind Berichte. Sie nähern sich seinen Beobachtungen und Erlebnissen immer mehr an. Entgegen dem Anschein gibt es im »Kleinen Prinzen« und der »Stadt in der Wüste« weniger Fiktives als in »Südkurier« und »Nachtflug«, wo Milieu und Figuren ausführlicher geschildert werden und ganz eigenständig sind. Schon diese frühen Werke sind eher Reportagen als Romane. Die Wirklichkeit wird darin kaum umgebildet. Noch weniger im »Kleinen Prinzen« und der »Stadt in der Wüste«, wo ein Moralexperiment knapp und sachlich beschrieben wird.
Saint-Exupéry verachtet, ja verabscheut Literatur, die nicht durch Realität gedeckt ist. Er will nichts schreiben, wofür er sich nicht mit seinem Leben verbürgen kann und das er nicht geprüft hat. So gesehen ist ihm die Welt der Literatur fremd. Er bleibt einer dieser einfachen Menschen, die ganz in der Wirklichkeit aufgehen und Produkte der Imagination höchstens als Ergänzung, nicht aber als Ersatz der Wirklichkeit ansehen.
Zur Unterhaltung gibt es Spiele: Schachprobleme, Anagramme, Kartentricks – Beschäftigungen, die in Almanachen vorkommen und die Saint-Exupéry begeisterten. Sie erfüllen ihren Zweck vorzüglich. Doch warum die Literatur auf Logogriphen beschränken? Von ihr darf man wohl mehr erwarten. Eben weil er an die Literatur glaubt, bevorzugt dieser Autor echte Anagramme, echte Logogriphen. Er verfaßt selbst welche; er widmet ihnen Freizeit und Phantasie. Er trennt die Aufgaben. Die Genres, Zuständigkeiten, Prioritäten werden bei ihm nie vermischt.
Saint-Exupéry lehnt noch ein anderes Schriftstellerprivileg ab, nämlich sich nicht an die Regeln halten zu müssen, die er dem Leser vorschreibt. Die Literatur begünstigt seit jeher auch Skrupellosigkeit und Heuchelei. Sie ermöglicht Feiglingen, Tapferkeit zu fordern, und Mutigen, die Segnungen der Angst zu loben; Geizigen, die Freigebigkeit zu preisen; Lüstlingen, die Keuschheit zu rühmen; Keuschen, die Lüsternheit zu verherrlichen und so weiter. Die Literatur dient zweifellos oft als Ausflucht oder Kompensation. Aber Saint-Exupéry macht sich nichts vor.
Er ist kein Asket, er kennt und genießt die Freuden der Sinnlichkeit. Er lebt weder maßvoll noch enthaltsam, frönt Faulheit, Wollust und Völlerei. Und denkt mit Zärtlichkeit an die Wärme und den Frieden abends im Familienkreis. Er hofft auf einen großen Preis, um alle Freuden des Lebens genießen zu können. Er hat vor dem Leben eine solche Achtung, daß er sich offenbar beherrschen muß, um nicht laut herauszuschreien, daß nichts, aber auch gar nichts die Opferung auch nur eines Menschen rechtfertige. Gleichwohl fordern seine Bücher dazu auf, Anstrengung statt Ruhe, Mühsal statt Freude, Gefahr statt Sicherheit zu wählen.
Die Menschen zum Verzicht auffordernd, betont er dennoch den Wert dessen, was sie verlieren. Er will sie nicht täuschen, er stellt sie vor die Wahl. Er macht ihnen das Glück nicht schimpflich; er beharrt auf der Heiligkeit des Lebens. Er denkt an die Piloten, die beim Aufbau einer Postlinie ums Leben kamen, an das beim Bau einer Brücke zerquetschte Gesicht eines Arbeiters. Ist eine Brücke den Tod eines Menschen wert? Oder die wenigen Stunden, um welche sich die Beförderung von ein paar Geschäfts- oder Liebesbriefen verkürzt? Das fragt er sich nicht nur einmal. Doch letzten Endes bejaht er Brücken und Postlinien. Seine Antwort hätte wohl anders gelautet, wenn das nicht sein Beruf gewesen wäre: unter Gefahren in unbekannter, lebensfeindlicher Umgebung neue Strecken zu erkunden. Dann hätte er die Antwort vielleicht bloß gedacht und nicht aufgeschrieben. Er glaubte wie gesagt an die Bedeutung der Literatur und verlangte von anderen grundsätzlich weniger als von sich selbst.
Er schreibt, um den Menschen den Sinn und die Tragweite ihres Tuns bewußtzumachen. Er sagt ihnen, was sie entzweit: man brauche ihnen nur ein Korn hinzuwerfen, und schon stritten sie. Aber auch, was sie eint: eine Aufgabe, die Zusammenarbeit erfordert. Der Koketten, die über ein verlorenes Schmuckstück weint, erklärt er, daß sie über den Tod weint, der sie von allem Schmuck trennt. Er versucht, bei jedem einen Sinn für die Moralgesetze zu wecken, die so unbeschränkt gelten wie die der Physik oder der Mechanik, nur vieldeutig, komplex, schwerer begreifbar sind als Windverhältnisse und Wetterschwankungen. Die Freiheit des Menschen macht alles unvorhersehbar. Doch gilt auch hier das ungeschriebene Gesetz, daß nichts verlorengeht und alles wiederkehrt.
Saint-Exupéry, der nicht eingestehen will, daß seine Literatur nicht so tiefgründig und nützlich wie Abc-Buch, Almanach und Katechismus ist, will dem Menschen mit seinen Büchern Kraft geben für die Prüfungen, die ihm seine Stellung als begabtes Tier auferlegt. Denn nichts hat dieses Tier dazu bestimmt, Brücken zu bauen oder Postlinien einzurichten, Bücher zu schreiben oder moralische Verpflichtungen einzugehen. Tiere brauchen keine Druckerei, keine Schrift, nicht einmal eine Sprache. Der Dschungel kann auf Logik und Moral verzichten. Doch sobald das Tier – infolge welcher unwahrscheinlichen Kausalkette? – den Instinkt überwindet und mehr als nur seine unmittelbaren Bedürfnisse befriedigen will, sind die Würfel gefallen, es beginnt ein unendliches Abenteuer, zu dem Brücken gehören, Postlinien, Kompaß, Steuern und Wehrdienst, die Inquisition, die Entdeckung Amerikas, die Eroberung Konstantinopels durch Kreuzfahrer oder Türken, Setzmaschinen, Bibliotheken, Fernsehen und schließlich Skepsis, wenn eine Kultur untergeht, die Lästereien derer, die gegen Logik und Moral sind.
Der nicht gläubige Held einer atheistischen Zeit hat nur die Werke und Fortschritte des Menschen, um sich vom Tier zu unterscheiden. Demnächst wird er sowohl den Wert der Werke als auch der Fortschritte in Frage stellen. Viele sind der Meinung, daß die Gewinne nicht die Verluste aufwiegen und die vielen Zwänge ein schlechter Tausch sind für die Unbekümmertheit. Und nicht zufällig suchen gerade die Empfindsamsten und Erfahrensten nach einer Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, die nicht vom Zivilisationsprozeß abgeleitet ist, sondern über ihn hinausgeht, ihn antizipiert und vielleicht erklärt oder rechtfertigt. Bezeichnenderweise stellt Saint-Exupéry die Definition des Menschen, die in André Malraux’ Frage steckt, ob die Freude nicht »von Anfang an vergiftet ist für das einzige Tier, das weiß, daß sie nicht dauern wird«, den Worten seines Kollegen Guillaumet gegenüber, der sich tagelang durch die verschneiten Anden kämpfte, obwohl sein Körper nur noch ausruhen und sterben wollte: »Was ich gemacht hab’, hätte kein Tier gemacht.«
Indem der Mensch sein Schicksal nicht mehr in die Hand der Götter legt, versucht er sich vom Tier zu unterscheiden. An beiden Fronten macht er denselben Versuch, aus berechtigtem Stolz und in kühner Unabhängigkeit. Er weiß, daß auf dem Olymp nur die Götter wohnten, die er sich eingebildet hat, aber er ist noch nicht soweit zuzugeben, daß sein Glaube an diese Projektionen wahrhaftig und fruchtbar war. Außerdem glaubt er sich immer noch dafür rechtfertigen zu müssen, daß er aus dem Tierreich stammt.
Aus dem Französischen von Gernot Krämer
SINN UND FORM 3/2010, S. 293-299