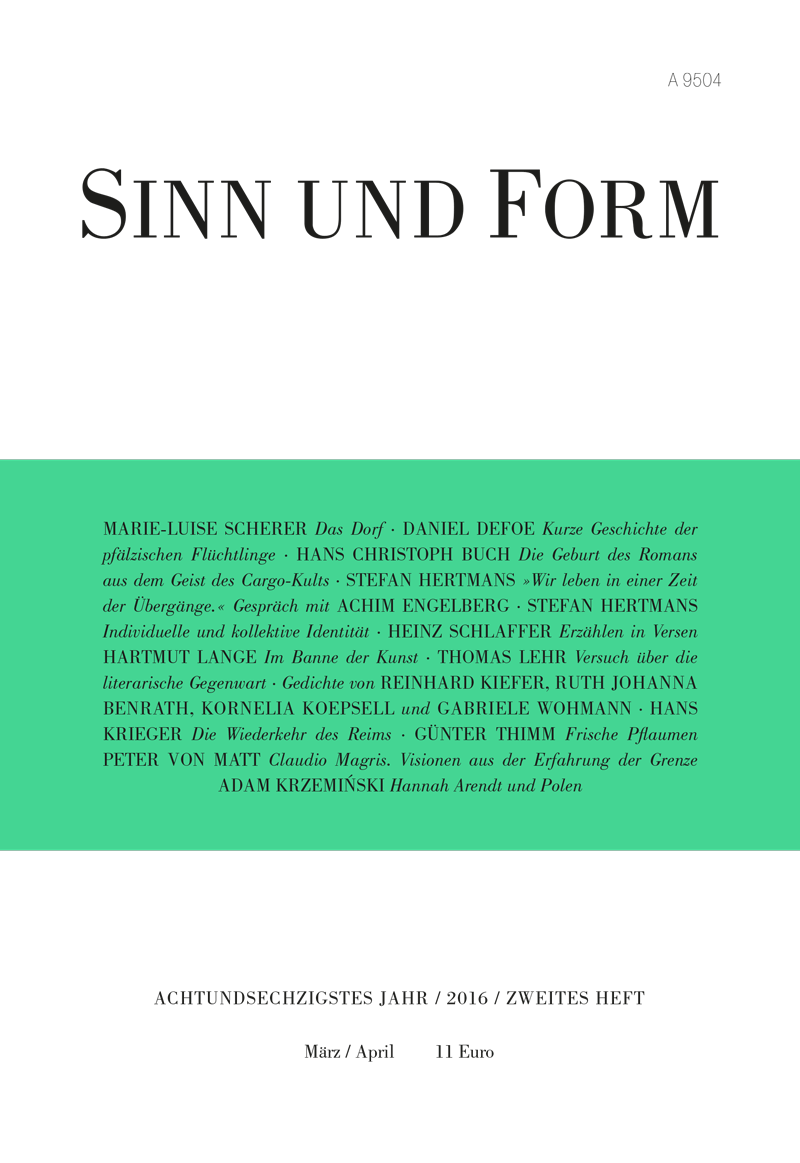Heft 2/2016 enthält:
Scherer, Marie-Luise
Das Dorf, S. 149
Koepsell, Kornelia
Stilles Leben. Gedichte, S. 161
Defoe, Daniel
Kurze Geschichte der pfälzischen Flüchtlinge. Mit einer Vorbemerkung von John Robert Moore, S. 164
Sehr geehrter Herr, in dem letzten Brief, den von Ihnen zu erhalten Sie mich auszeichneten, beliebten Sie, außer anderen wichtigen Dingen, welche (...)
Buch, Hans Christoph
Die Geburt des Romans aus dem Geist des Cargo-Kults. Eine Robinsonade, S. 201
Wohmann, Gabriele
Schlußapplaus. Gedichte, S. 214
Engelberg, Achim
»Wir leben in einer Zeit der Übergänge.« Gespräch mit Stefan Hertmans, S. 217
ACHIM ENGELBERG: Etliche Autoren, die über den Völkermord an den europäischen Juden oder die Schrecken der Lagerwelt des 20. Jahrhunderts (...)
Hertmans, Stefan
Zwischen Gedenken und Erinnern. Über individuelle und kollektive Identität, S. 228
»Der Himmel meines Großvaters« basiert auf der Geschichte, genauer den Aufzeichnungen meines Großvaters mütterlicherseits, in deren Mittelpunkt (...)
Benrath, Ruth Johanna
Und die seligen Augen (Letzte Fassung). Gedichtzyklus, S. 236
Schlaffer, Heinz
Erzählen in Versen, S. 241
Lange, Hartmut
Im Banne der Kunst. Leipziger Poetikvorlesung, S. 251
Kiefer, Reinhard
Die Urwelt steht ihnen offen. Gedichte, S. 262
Lehr, Thomas
Der Schmetterling der Zeit. Versuch über die literarische Gegenwart, S. 264
Krieger, Hans
Die Wiederkehr des Reims. Form als Sinn – zu einem Gedicht von John Donne, S. 273
Zu den erstaunlichsten Entwicklungen der neueren Lyrik gehört die geräuschlose Rehabilitierung des Reims. Lange war er verpönt gewesen als Relikt (...)
Thimm, Günter
Frische Pflaumen. Enzensberger und Detering übersetzen William Carlos Williams, S. 275
Matt, Peter von
Claudio Magris. Visionen aus der Erfahrung der Grenze, S. 280
Krzeminski, Adam
Hannah Arendt und Polen, S. 281