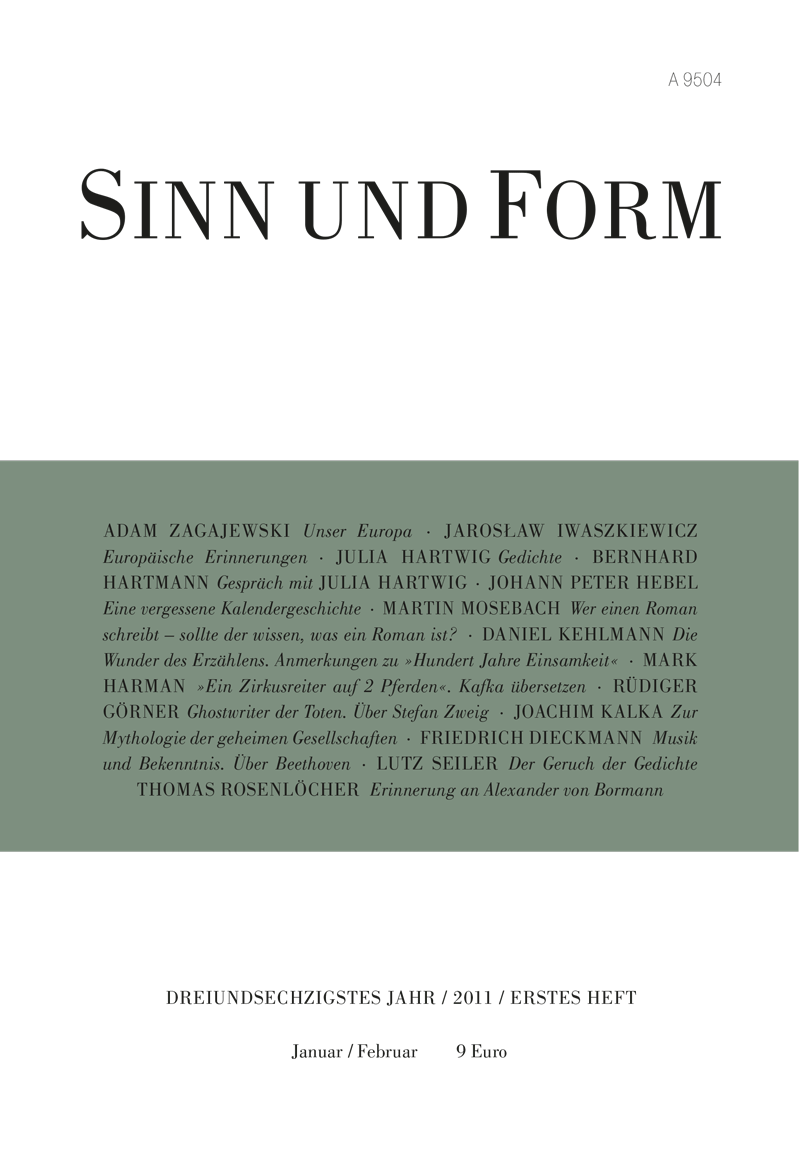Heft 1/2011 enthält:
Zagajewski, Adam
Unser Europa, S. 5
Vor nicht allzu langer Zeit waren viele Europäer bereit, für ihr Land, für Frankreich, Deutschland oder auch Polen, zu sterben. Für Europa (...)
Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Europäische Erinnerungen, S. 11
Hartwig, Julia
Gedichte, S. 22
Hartmann, Bernhard
Gespräch mit Julia Hartwig, S. 31
Hebel, Johann Peter
Eine vergessene Kalendergeschichte. Mit einer Vorbemerkung von Heinz Härtl, S. 43
Mosebach, Martin
Wer einen Roman schreibt - sollte der wissen, was ein Roman ist?, S. 46
Ich war dreißig Jahre alt und hatte soeben meine juristischen Studien mehr schlecht als recht abgeschlossen und noch keine der kleinen Erzählungen (...)
Kehlmann, Daniel
Die Wunder des Erzählens. Anmerkungen zu »Hundert Jahre Einsamkeit«, S. 65
Harman, Mark
»Ein Zirkusreiter auf 2 Pferden«. Kafka - Übersetzung und Jiddischkeit, S. 78
Görner, Rüdiger
Ghostwriter der Toten. Biographisches Erzählen bei Stefan Zweig, S. 85
Kalka, Joachim
»Das Unterirdische geht so natürlich zu als das Überirdische«. Zur Mythologie der geheimen Gesellschaften, S. 93
Was hat es auf sich mit den geheimen Gesellschaften? Der vielleicht erste Historiker, der sich sine ira et studio mit ironisch-professioneller (...)
Dieckmann, Friedrich
Bekenntnisse und Liebesgeschichten. Anmerkungen zu Beethoven, S. 112
Seiler, Lutz
Der Geruch der Gedichte. Dankrede zum Fontane-Preis, S. 133
Rosenlöcher, Thomas
Die unten im Wasser zitternden Lichter. Kleine Erinnerung an Alexander von Bormann, S. 135