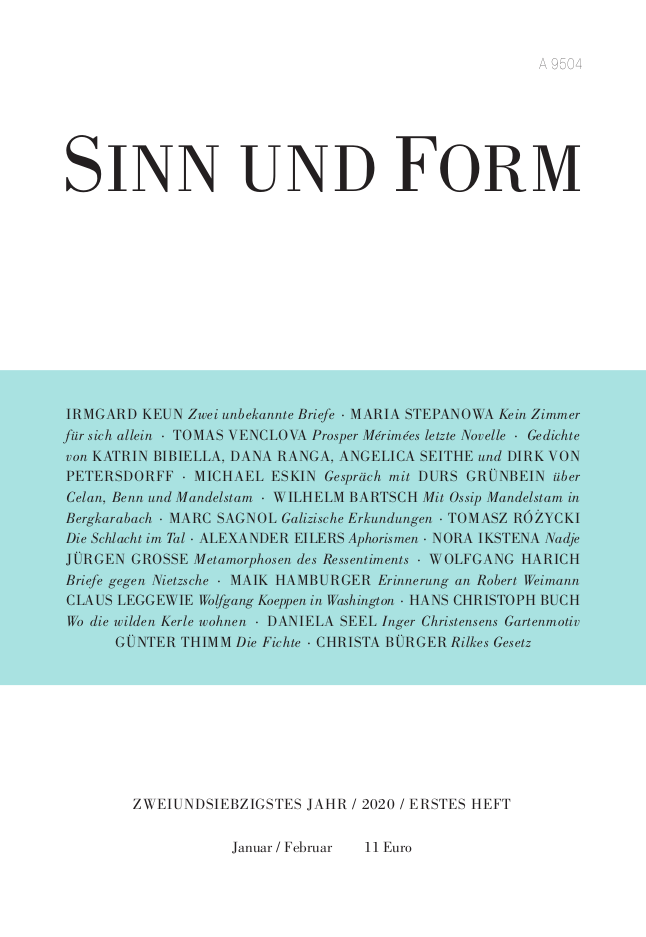
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-51-5
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 1/2020
Sagnol, Marc
Galizische Erkundungen. Sambor, Stryj, Bolechów
SAMBOR
Am Fuße der Karpaten, an der Straße, die hinauf zu den Almen der Polonina führt, liegt die Stadt Sambor anmutig über dem Dnjestr, der hier noch ein schmales Flüßchen ist, bevor er breiter wird und sich in Mäandern durch die galizische Ebene schlängelt, um größere Städte wie Mogiljow Podolski und Jampol mit Wasser zu versorgen, und schließlich als mächtiger Strom bei der Festungsstadt Belgorod Dnestrowski ins Schwarze Meer mündet.
Doch in Sambor deutet kaum etwas darauf hin, daß dieser schäumende Wasserlauf irgendwann solche Dimensionen annimmt, in seinem Verlauf von so vielen Bächen und Flüssen gespeist werden wird, wie der Strypa, dem Seret oder dem Sbrutsch in Podolien. Eine Brücke führt über den Dnjestr, dann überquert man einen weiteren Wasserlauf, die Mlynowka, den »Mühlbach«, der die kulturelle Grenze zwischen der Stadtmitte und dem jüdischen Ghetto bildete. Lange Zeit war Sambor, wie die meisten galizischen Marktflecken, in zwei ungleiche Teile geteilt, das Zentrum, bürgerlich, polnisch, lag auf der Anhöhe, während sich an den Ufern der Mlynowka und des Dnjestr die Unterstadt erstreckte, zunächst das jüdische Viertel und anschließend die ruthenischen Dörfer.
Einst jedoch erhob sich ein berühmtes Schloß in Sambor, nicht in der Oberstadt, sondern dort, wo sich heute das ärmliche Viertel Blich befindet, nicht weit vom Ufer des Dnjestr entfernt. Dort residierte der Woiwode Jerzy Mniszech, Sproß eines bedeutenden polnischen Adelsgeschlechts, der hier den »falschen Dimitri« empfing und ihm die Hand seiner Tochter Marina anbot, bevor dieser selbsternannte Zar 1604 zur Eroberung Moskaus aufbrach. In Puschkins Drama »Boris Godunow« wird geschildert, wie der entlaufene Mönch, der vorgibt, der im Alter von sieben Jahren in Uglitsch ermordete Zarewitsch Dimitri, der Sohn Iwans des Schrecklichen, zu sein, sich zunächst in Krakau, dann in Sambor auf seinen Feldzug gegen Moskau vorbereitet.
Wir brechen, Kameraden, morgen früh
Von Krakau auf. Auf deinem Landsitz Mniszech,
Werd ich voraussichtlich drei Tage rasten.
Dein gastfreundliches Sambor ist berühmtDurch die gewählte Ausstattung des Schlosses
Und durch die Schönheit seiner jungen Wirtin.
Ich hoffe sehr, die liebliche Marina
Dort anzutreffen …
(Nachdichtung von Manfred von der Ropp)
Die folgende Szene spielt sich im »Schloß des Statthalters Mniszech in Sambor« ab: Hier hat der falsche Dimitri abends am Springbrunnen ein Stelldichein mit Marina, erklärt ihr seine Liebe und verspricht ihr, Moskau für sie zu erobern. In der russischen Geschichte ist diese kleine polnische Provinzstadt seitdem berühmt, aber auch berüchtigt, denn Dimitri gelang es tatsächlich, Moskau zu erobern, sich zum Zaren krönen zu lassen und sich ein Jahr lang auf dem Thron zu halten. Dann wurde er seinerseits ermordet, man zerstückelte seinen Leichnam und schoß die Überreste mit einer Kanone in Richtung Polen. Sambor ist gleichsam das Gegenstück zu Uglitsch am Ufer der Wolga, wo man die Kirche des Heiligen Dimitri »zum vergossenen Blut« besichtigen kann, die an der Stelle errichtet wurde, wo der Siebenjährige starb. Bis heute ist umstritten, ob der Zarewitsch im Auftrag des Regenten Boris Godunow ermordet wurde oder sich versehentlich selbst eine tödliche Verletzung zufügte, wie es die offizielle Version damals behauptete.
Vom Schloß Sambor ist praktisch nichts mehr übrig, vielleicht, weil es in der Unterstadt, nicht weit vom Dnjestr stand. Noch 1919 wies der große Galizien-Kenner Mieczyslaw Orlowicz in seinem Reiseführer darauf hin, daß man in Blich einige »Überreste der Befestigungsanlagen des Schlosses des Woiwoden Mniszech « besichtigen könne, doch heute sind diese nicht mehr auffindbar. Blich ist noch immer ein ärmliches Viertel, aber wenn man sich dem Ufer des Dnjestr nähert, gelangt man in eine Gegend mit freistehenden Häusern, Villen und einem großen Park. Alles deutet darauf hin, daß sich hier das Schloß befand.
Doch auch abgesehen vom Schloß haben sich in Sambor sehenswerte Spuren der polnischen Aristokratie erhalten, welche die Stadt geprägt hat, ebenso wie einige bescheidenere Überbleibsel der beiden alten jüdischen Viertel, die früher die Unterstadt bildeten und die Artur Sandauer in seinen »Notizen aus der toten Stadt« anschaulich schildert: Das eine, Targowitza genannt, lag am linken Ufer der Mlynowka, direkt unterhalb der Oberstadt und wurde von den »aufgeklärten« Juden bewohnt, die sich von den Bewohnern des Ghettos abgrenzen und der polnischen Kultur assimilieren wollten. Das andere trug den Namen Blich und lag am rechten Ufer der Mlynowka. Es handelte sich um ein echtes Ghetto, eine in sich abgeschlossene Welt, geprägt von chassidischer Religiosität, überlieferten Traditionen und nicht zuletzt der jiddischen Sprache. Als Artur Sandauer 1939 nach neun Jahren Abwesenheit in seine Geburtsstadt zurückkehrte, nahm er deren Topographie mit neuen Augen wahr. In seinem Roman beschreibt er drei voneinander abgeschlossene Viertel, drei Welten mit ganz unterschiedlichen Farben und Gerüchen: Rynek, Targowitza und Blich, deren anfangs klar gezogene Grenzen nach und nach immer fließender werden:
»Mein Geburtsort, Targowitza, war zur einen Seite, durch die Brücke über die Mlynowka, mit dem tiefsten Ghetto verbunden, zur anderen Seite, durch die Treppen, mit dem Marktplatz, dem Viertel der Amtsgebäude, der Schulen und der Kirchen. Der Umstand, daß der Marktplatz auf einer Anhöhe gelegen war, nahm für mich eine existentielle Bedeutung an. Wenn man die Treppen zum jüdischen Viertel herabstieg, stieg man zugleich auf der gesellschaftlichen Stufenleiter herab. Der Abstieg war jedoch nicht unmittelbar. Im Targowitza-Viertel waren die Häuser weniger baufällig und man hörte neben jiddisch auch polnisch sprechen. An den Markttagen, wenn die Bauern mit ihren Fuhrwerken den Platz bevölkerten, kam noch eine dritte Sprache dazu: ukrainisch.
Überquerte man die Brücke über die Mlynowka, dann gelangte man von Targowitza ins Herz eines dunklen Kontinents, ins Ghetto am rechten Flußufer. In Blich, wo sich Dutzende baufälliger Häuschen mit von verrotteten Schindeldächern halbverdeckten Fenstern aneinanderkauerten, sprach man nur jiddisch oder, wie man damals sagte, ›Jargon‹. Am Freitagabend erklangen hinter den erleuchteten Scheiben auch hebräische Gesänge.«
Der Dnjestr und der Rynek übten jeweils eine ganz unterschiedliche Faszination auf Sandauer aus. Der Rynek, das war die griechisch-lateinische Hochkultur, die er in der Schule in sich aufnahm, der Dnjestr stand für die slawische Welt, die Wälder, aber auch für die sündhafte Seite des menschlichen Daseins. Der Rynek war Griechenland, der Dnjestr Sizilien. Die Topographie bestimmte natürlich auch sein Liebesleben, und das junge Mädchen, das er im Rynek-Viertel kennenlernt, vor dem glänzenden Hintergrund der Villen und Jugendstilhäuser, wohnt natürlich in der Nähe des Dnjestr, und er beobachtet sie eines Tages mit einem anderen Verehrer am rechten Flußufer. Wie der Proustsche Erzähler spielt der Autor die verschiedenen Gegenden der Stadt gegeneinander aus. Seine Jugend ist von einem zweifachen topographischen Paradoxon bestimmt: Da ist einerseits das mehr oder weniger neutrale Terrain des Targowitza-Viertels, ein Ort des Übergangs, »eine Art Bushaltestelle an der Straße von Blich zum Rynek, an der seine Eltern ausgestiegen waren, um ihre Fahrt nicht weiter fortzusetzen «, und andererseits die Tatsache, daß man ins Paradies, in die Traumwelt des rechten Flußufers, nur gelangte, indem man den Weg durch die Hölle von Blich nimmt. Er durchquert dieses Viertel stets mit einem Gefühl der Unsicherheit und Bedrohung und ekelt sich vor seinen offenen Abwasserkanälen, durch die sich aller Unrat der Oberstadt ergießt und die ihm nur zwei Jahre später, während der deutschen Besatzung, das Leben retten werden.
Trotz des Altersunterschieds zwischen ihnen kam es zwischen Bruno Schulz und dem zwanzig Jahre jüngeren Artur Sandauer 1938 zu einer Bekanntschaft, die zur Freundschaft wurde. Die Briefe von Schulz an Sandauer sind verschollen, einige Briefe des Jüngeren haben sich jedoch erhalten:
»Lieber Herr Bruno, ich bin überwältigt von Ihrem Brief. Ich habe keine Worte des Glücks, keine Worte des Trostes. Ich wünschte, ich wäre bei Ihnen. Ich liebe Sie schon seit langem um Ihres Werks willen, jetzt liebe ich Sie um Ihres Leidens willen.« (12. Mai 1938) Einen Monat später sind beide zum Du übergegangen. Die Frühreife des jungen Schriftstellers scheint Bruno Schulz beeindruckt zu haben: »Dieser Sandauer, der im ›Pion‹ über Gombrowicz schreibt, ist ein guter Bekannter von mir, ein 23jähriges Bürschchen, sehr intelligent«, schreibt er an seine Freundin Romana Halpern (23. Januar 1938). Die letzte Postkarte, die Sandauer im November 1942 an Schulz schickte, kam mit dem Vermerk »Empfänger unbekannt« zurück.
Um in das alte Viertel Blich zu gelangen, dessen Name sich von »bleichen« ableitet, da hier früher Wäschereien ansässig waren, überquert man hinter dem Busbahnhof das Gewässer, das Sandauer die Mlynowka nennt, einen halb ausgetrockneten und zur Kloake gewordenen Bach, und kommt in eine düstere Gegend, deren Hauptstraße immer noch Torgowa heißt. Hier finden sich einige Läden, Getränkestände, Geschäfte, in denen billige Möbel, Eisen- und Haushaltswaren oder gebrauchte Kleidung nach Gewicht verkauft werden, Schaufenster des lokalen Elends. Das einzige, was fehlt, sind die ehemaligen jüdischen Bewohner, die sich buchstäblich in Rauch aufgelöst haben. Am Ende der Straße, vor einem Fabrikeingang, stößt man auf die Reste der alten Synagoge, 1763 erbaut und seit der deutschen Besatzung profaniert: ein großes Gebäude, dessen Fenster mit Holzplatten mit den Aufschriften »Speisesaal« und etwas weiter »Night club« vernagelt sind. Nur die längliche Form des Bauwerks und das Dach mit seiner einzelnen Mansarde ermöglichen es, die Synagoge anhand eines Fotos aus der Vorkriegszeit zu identifizieren. Das angrenzende Gebäude, das früher ebenfalls dazugehörte, dient heute als »Motel« und trägt den russischen Namen »Randewu« (Rendezvous). Der Eingang ist mit Fotos von jungen Frauen dekoriert, die Zimmer werden stundenweise vermietet. Gerade tritt eine Frau aus dem Gebäude, die mit sehr knappen Shorts bekleidet ist und ihr Make-up nachzieht. Von Blich aus hat man einen guten Ausblick auf die Kirchen, welche die Silhouette der Oberstadt prägen.
Steigt man die Treppen oder eine der abschüssigen Gassen am Hang hinauf, gelangt man auf den Marktplatz, in dessen Mitte sich das Rathaus mit seinem Belfried erhebt, auf dem eine ukrainische Fahne weht. Auf allen Seiten grenzen Kirchen und Klöster an den Platz. Die alte Zisterzienserkirche, die die Anhöhe beherrscht, ist heute ein Konzertsaal für Orgelmusik. Der Marktplatz wird von zwei asymmetrischen Promenaden flankiert, die man zu österreichischer, aber auch noch zu polnischer Zeit die Linie A-B – welche die vornehmere war – und die Linie C-D nannte. Man sieht sie auf alten Postkarten und sie lassen sich bis heute gut erkennen, vor allem die Linie A-B mit ihren Bänken, die wie für Liebespaare beim ersten Stelldichein gemacht zu sein scheinen.
Gleichsam aus umgekehrter Perspektive wie Artur Sandauer, dessen Blick sich von Targowitza aus nach oben, hinauf auf den Marktplatz richtete, beschreibt Andrzej Kuśniewicz die Stadt in seinem Roman »Nawrócenie« (Bekehrung). Er läßt seinen Blick von dort aus über die Unterstadt schweifen und versucht, das ihm fremde Stadtviertel in sich aufzunehmen, dem er, in Anlehnung an die Mlynowka, den »Mühlbach«, den Namen »Hintermühlen« gibt: »Rechts zieht sich ein Stück der Linie A-B schräg durch das Blickfeld. Links biegt die Straße ab, die bis hinunter nach Hintermühlen führt. Und gerade gegenüber steht das Rathaus mit einem von einem Pfeil durchbohrten Hirsch auf der Turmspitze. Auf dem ziemlich weitläufigen Großen Platz kommen und gehen die Bauern in ihren Schaffellmänteln und im Sommer in weißen Leinenhemden, die über ihre Hosen allen.« Der Erzähler setzt seinen Rundgang durch die Stadt fort, indem er langsam in die Vorstädte »Über’m Fluß« und »Hintermühlen«, Targowitza und Blich, hinabsteigt, deren exotischer Reiz ihn aus der Ferne lockt.
Obwohl Kuśniewicz zur polnischen Aristokratie gehört, übt die jüdische Welt eine starke Anziehung auf ihn aus, wie schon vor ihm auf Schriftsteller wie die Romanautorin Eliza Orzeszkowa oder den polnischen Nationaldichter Mickiewicz, der in seinem Versepos »Pan Tadeusz« einer jüdischen Figur, dem Schankwirt und Musiker Jankiel, eine zentrale Rolle einräumt. Kuśniewicz nutzt jede Gelegenheit, um in die Unterstadt hinabzusteigen, in das Viertel, »wo es dunkel ist wegen der Kaftane und hell vom Licht der Sabbatkerzen, wo es alte Häuser gibt, die halb in der Erde versunken sind, Gossen voller Schmutzwasser und lärmende Kinder, die darin herumtollen«. Von dieser Welt in ihren Bann gezogen, entfremdet er sich mehr und mehr der Welt seiner Herkunft, bis er sich schließlich nirgends mehr zu Hause fühlt. »Den Marktplatz habe ich hinter mir gelassen, und auf der anderen Seite des Flusses überschreite ich die Grenze, die Grenze des Fremden und des Schreckens zugleich. Ich fühlte mich unbehaglich. Denn hier, auf diesem Boden, bin ich ein vollkommener Außenseiter. Von überallher von Hunderten Blicken beobachtet.«
Kuśniewicz, der Voyeur, träumt davon, ein Teil der Welt zu werden, die Gegenstand seiner Beobachtung ist: »Sie beobachten mich, starren mich an, als ob ich bereits einer der ihren wäre. Aber das ist Einbildung. Ich ergreife also die Flucht und werfe meinen Hut in den erstbesten Rinnstein. Pah, lassen wir das, eine folgenlose Phantasterei. Es war nur eine Fiktion.«
Der Erzähler taucht hier aus einer Phantasmagorie empor, die in der Tradition von Bruno Schulz steht: Auch dieser verhält sich gegenüber der jüdischen Gemeinschaft von Drohobycz wie ein Voyeur. Zwar ist er ein Teil dieser Gemeinschaft, wird jedoch gleichzeitig zum »Verräter« an ihr, indem er sie mit dem Blick eines Außenstehenden beobachtet, der sich über eine fremdartige Welt beugt, die Welt der Zimtläden und der chassidischen Feste.
(…)
Aus dem Französischen von Andreas Fliedner
SINN UND FORM 1/2020, S. 58-68, hier S. 58-63
