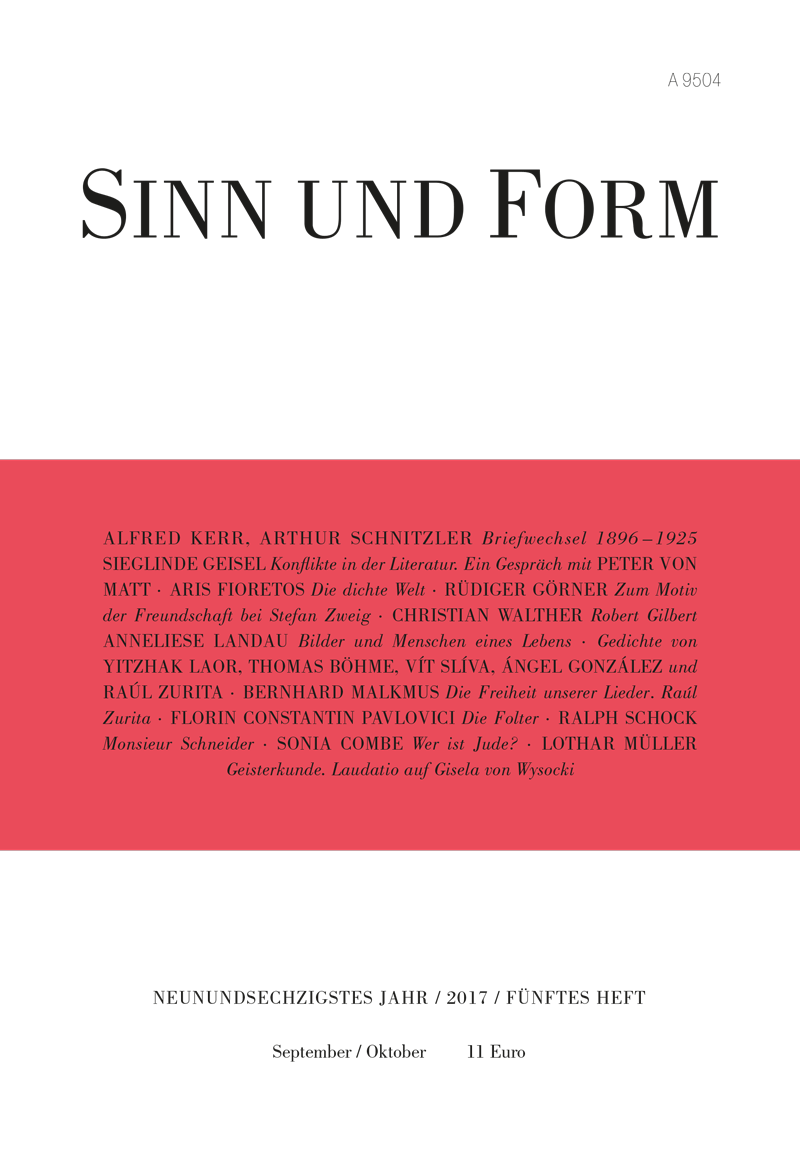Leseprobe aus Heft 5/2017
Fioretos, Aris
Die dichte Welt
Hinc Poenus, hinc Afer urget.
(Prädikat im Sing. merken.)
Hier dringen die Punier und dort die Afrikaner ein.
– Erik Tidner, Latinsk grammatik (1965)
Das Gewirr war dicht, nicht besonders schön, undurchdringlich. In einer Zeit, in der von schwedischen Gymnasiasten erwartet wurde – es waren noch die grauen siebziger Jahre –, daß sie Bleistift und Radierer verwendeten, schrieb J. stets mit Kugelschreiber. Am liebsten benutzte er einen mit vier Farben: rot, grün, blau, schwarz. Trotz der Auswahl nahm er immer die schwarze Tinte. Während ich über die Frage nachdachte, die der Lateinlehrer uns gerade gestellt hatte (es ging um die dritte Person Singular von esse im Futurum exactum), klickte er mit seinem Kugelschreiber – vorgebeugt, den Ellbogen auf dem Tisch und seinen Mund gegen den Handrücken gedrückt. Ich ahnte ein kompliziertes Lächeln. J. mußte nicht lange über die Antwort nachdenken. Er hatte Latein binnen eines Herbstmonats gelernt und widmete sich nunmehr seinen privaten Studien. Nichtsdestotrotz dauerte es noch einige Wochen, bis ich verstand, was sich hinter dem Tintendickicht verbarg.
Wir waren ein ungleiches Paar – ich ein gelegentlich schwänzender Herausgeber der Schülerzeitung und gut in Sport; er ein gewissenhafter Genius, aber ungelenk. Außerdem waren wir Sitznachbarn, also schielte ich in J.s Heft in der Hoffnung, dort die richtige Antwort zu finden. Tinte konnte nicht wegradiert werden, dennoch fand ich keine passende Verbform im Dickicht. Jedesmal, wenn er mit dem, was er aufgezeichnet hatte, nicht zufrieden war, überschrieb er es mit kleinen Ösen – eine endlose Folge von zusammengedrückten Schreibschrift-o’s, die, als er nochmals über die Zeile ging, zu Stacheldraht wurden. Es war nicht vorgesehen, daß jemand das Geschriebene entziffern konnte. Niemand, auch er nicht, durfte das Dickicht durchdringen und die Worte dahinter erblicken. Am Ende des Schultags wölbte sich die gefüllte Seite im Heft.
Neben Latein war der Selbstmord die große Herausforderung dieses vorletzten Herbsts im Gymnasium. Wir sortierten die Argumente während der Mittagspause in der Bibliothek. Am Ende blieben zwei radikale Alternativen. Diejenigen von uns, die den Tod von eigener Hand bejahten, sahen ihn als letzten Willensakt eines Menschen. Der Selbstmörder war Kapitän auf der SMS Ich, die gerade mit wehender Fahne sank, stolz oder trotzig bis zuletzt. Wer wollte sein Leben nicht so beenden, auf der Kommandobrücke, breitbeinig, die Finger an der Schirmmütze?
Diejenigen, die gegen den Freitod waren, betrachteten ihn dagegen als klarstes Zeichen dafür, daß ein Mensch die Macht über sich selbst verloren hatte. Hier konnte von einem Tod von »eigener« Hand keine Rede sein. Im entscheidenden Augenblick, als das Leben den Menschen verließ, möglicherweise mit einem erleichterten Seufzer, änderte sich sein grammatischer Status. Als Selbstmörder stand man, strenggenommen, nicht in der ersten, sondern in der dritten Person Singular. Man war zum ichlosen Jemand geworden, der freiwillig das Ruder aus der Hand gegeben hatte. Auf der SMS Nicht-Ich blieben nur die Ratten zurück. Und wer wollte ihnen das letzte Wort überlassen?
Wir waren fünf Jungen in der Klasse II, Humanistischer Zweig, die sich um das Schachbrett in der Bibliothek versammelten. Zwischen den Zügen wurden die Argumente geprüft. Als es schließlich Zeit wurde abzustimmen, waren zwei für, zwei gegen den Selbstmord. Der fünfte in unserer Gruppe weigerte sich, Stellung zu beziehen. Heute, viele Jahre später, ist die Hälfte von uns noch am Leben. Derjenige von uns, der das Thema vorgeschlagen hatte, der Klassen-Existentialist, der unsere Gruppe mit eigenhändig gebundenen Photokopien philosophischer Grundtexte versorgte, wurde Psychotherapeut in einem Nachbarland. Der Sohn des Priesters, der Kierkegaard mochte und es in die Leichtathletik-Nationalmannschaft schaffte, starb kurz vor der Jahrtausendwende. Was mit dem Trompeter in der Heilsarmee passierte, weiß ich nicht. Aber der letzte in unserer Runde, er, der sich nicht zwischen Ja und Nein entscheiden wollte, nahm sich das Leben. Das war J.
J. trug einen Nachnamen, der mit son endete und zu den häufigsten unseres Landes zählt. In seinem Fall war es schwierig, die deutsche Bedeutung des Namens wegzudenken: Was auch immer J. war, er war anders als wir, er war Anders’ Sohn. Auch der Vorname war apart. Nicht weil er unter Jungen unserer Generation ungewöhnlich gewesen wäre. Sondern weil J. ihn als Bezeichnung für das, was sich hinter dem Dickicht in seinem Schreibheft versteckte, benutzen sollte.
Da die Abstimmung die Frage nicht gelöst hatte, debattierten wir weiter. Der Kamerad mit Zugang zu einem Kopierer meinte, der Selbstmord sei die erste philosophische Frage, zu der man als Erwachsener Stellung beziehen mußte; also auch wir. Im Unterschied zum Ablativus absolutus und zu Integralrechnungen, Gottesbeweisen und zum Theodizeeproblem konfrontiere sie uns mit einer ebenso praktischen wie grundlegenden Frage: War das Leben es wert, gelebt zu werden? Wer konnte behaupten, daß es eine wichtigere Antwort gab? Er persönlich betrachtete den Freitod eher als denkbaren Ausweg denn als verbotene Sackgasse. Ein Mensch war demnach in der Lage, die Herrschaft über sich selbst bis zum letzten Atemzug zu bewahren. Und keine anderen Mächte – Staat, Kirche oder Krankheit, Mißwirtschaft, unglückliche Liebe – darüber entscheiden zu lassen, wann das Leben enden sollte, sondern selbst den Schlußpunkt zu setzen.
Bei näherer Betrachtung, gab der Klassenexistentialist zu bedenken, verfüge der Suizidale über mehrere Möglichkeiten und Techniken. Da gab es den Strick, der nur einen Dachbalken brauchte, wonach die Schwerkraft den Rest erledigte. Da gab es Steine, die in die Taschen gestopft wurden, bevor man ins Wasser watete. Und da gab es die Eisenbahnschienen zwischen unserer und der größeren Nachbarstadt, die allerdings, da waren sich alle einig, eine unwürdige Lösung waren. Der Lokführer würde nach dem Schock nicht mehr derselbe sein, und ein philosophisch geschulter Selbstmörder zog andere nicht mit ins Verderben. Da gab es schließlich die Schlaftabletten der Eltern, unsere eigenen Rasierklingen und die wenigen Gasöfen, die man noch in den Abrißhäusern hinter dem Bahnhof finden konnte, wohin einer von uns gerade umgezogen war.
Aber die würdevollste Art, sich das Leben zu nehmen, warf ich ein, der wahre Triumph, war das nicht der Revolverschuß? Der Knall am Haaransatz schien mir der finale Paukenschlag zu sein. So nahm der technisch versierte Suizidvirtuose doch Abschied, wenn er das letzte Ereignis seines Lebens nicht anderen Mächten überlassen wollte – in einer Wolke aus Pulverdampf, die das Bewußtsein ein für alle Mal auslöschte, ohne Hoffnung auf ein Comeback. Richtig ausgeführt war der Revolverschuß sogar einen Artikel in der Schülerzeitung wert.
Die Proteste ließen nicht auf sich warten. Wußte ich denn nicht, wie leicht man das Ziel verfehlte? Im kritischen Augenblick zitterte meistens die Hand – ob aus Feigheit, Angst oder Zaudern spielte kaum eine Rolle – und man fügte sich nur eine fatale Wunde zu. Wünschte ich mir, den Rest meines Lebens als lallender Idiot in einer der Nervenheilanstalten am Rande der Stadt zu verbringen? Virtuo se? Pah. Von wegen. Wenn ich es wider Erwarten schaffte, mir einen Revolver zu besorgen, mußte ich die Mündung in den Mund stecken. Nur wenn das Metall gegen den Gaumen drückte, konnte ich sicher sein, künstlicher Ernährung und Erwachsenenwindeln zu entgehen. Inwiefern die Spritzer an der Wand hinter mir ein gepflegter Abgang waren, müßten die Klassenkameraden entscheiden, die die ästhetischen Fächer des humanistischen Zweigs belegten.
Während unserer Diskussionen sagte J. nicht viel. Meistens saß er, den Ellbogen auf dem Tisch und den Mund gegen seinen Handrücken gepreßt, tief in die Folgen eines hypothetischen Zugs auf dem Brett versunken. Die Oberlippe zierten weiche, schwarze Haare, sonst war sein Gesicht von bösartigen Pubertätsausschlägen bedeckt, die er mit einer dicken weißen Paste behandelte. Er wechselte zwischen zwei Hemden – das eine lachsrosa, das andere pistaziengrün, beide auf der Innen- und Außenseite schmutzig. Die Manschetten blieben zugeknöpft, nicht nur während der warmen Jahreszeit, sondern auch im Sportunterricht, wenn er zwar zur kurzen Hose wechselte, aber es vorzog, Hemd und Unterhemd anzubehalten.
Während wir Basketball spielten, trieb J. für sich alleine Sport. Seine Übungen beschränkten sich für gewöhnlich auf einen Marsch an den Sprossenwänden entlang. Wechselweise hob er die Knie bis zum Brustkorb, die Füße setzte er mit der ganzen Sohle auf den Boden. Gleichzeitig bewegten sich seine geballten Fäuste auf und ab, als hielte er einen Krummstab oder eine Standarte. Gelegentlich konjugierte er dabei lateinische Verben, am liebsten sang er jedoch Wagner. J. hatte eine tiefe und schöne Baßstimme, die vor Zorn zittern, vor Indignation beben konnte. Und wenn sie sich den sumpfigen Böden der Traurigkeit näherte, bekam sie etwas ebenso Verschwommenes wie Bodenloses – als wüßte diese Stimme unendlich mehr über Verluste als wir anderen.
Siegfried und Parsifal waren seine großen Helden, aber wenn J. sang, machte er sich lieber zum Sprachrohr Alberichs, des ersten Besitzers des Rings, oder auch des alten Titurel, des Königsvaters, der über den Gral wacht. Manchmal versetzte er sich sogar in Fafner, den Drachen, der sowohl das Rheingold als auch den Herrscherring schützt. Aus J.s tiefer Stimme sprach ein älteres Wissen, eine Erkenntnis, die jüngere Generationen nicht verstehen werden können.
Sobald er bei einer Arie steckenblieb, was stets passierte, bevor er die vierte Sprossenwand erreichte, mußte J. von vorn anfangen – nicht vom Legato, bei dem seine Zunge gestolpert war, sondern vom ersten Takt an, so daß er nie zum Ende kam, ehe die Schulglocke läutete. Es gab etwas in seiner Körpermotorik, etwas mit Rhythmus und Satzfügung Zusammenhängendes, das niemand verstand. Eine dunkle, geheime Mechanik, eine Einübung in eine andere Gangart, die auf seine persönliche Beziehung zur Welt verwies. Aber auch wenn wir nicht begriffen, welche Kräfte ihn antrieben, konnten wir uns kaum des Eindrucks erwehren, daß der Versuch, ohne Rückschlag durch das Solostück zu kommen, etwas mit dem Tintendickicht in seinem Schulheft zu tun hatte. Die Wiederholung war die einzige Methode, mit der J. einen Fehler zugleich ausradieren und vergessen machen konnte. Der Fehlversuch wurde mit neuen Tönen überschrieben. Und wieder neuen.
[...]
SINN UND FORM 5/2017, S. 631-642, hier S. 631-634