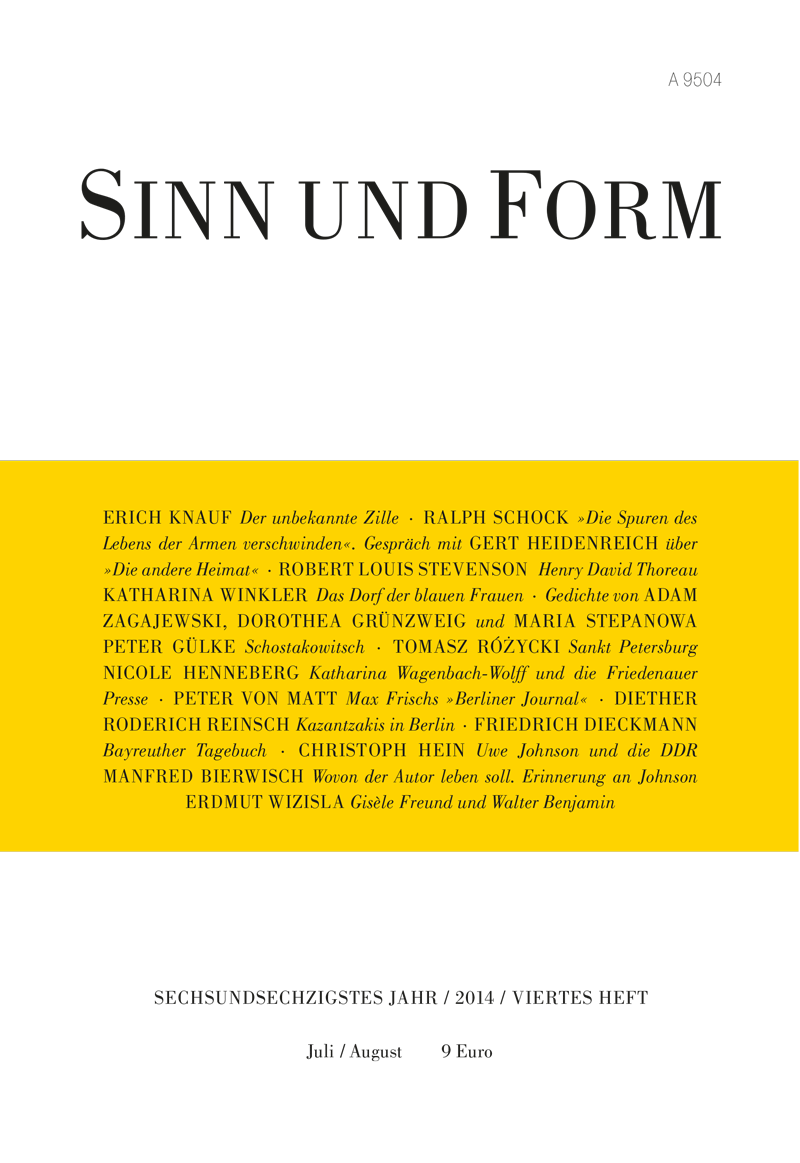Leseprobe aus Heft 4/2014
Stevenson, Robert Louis
HENRY DAVID THOREAU
Sein Charakter und seine Überzeugungen
I
Thoreaus schmales eindringliches Gesicht mit der großen Nase deutet selbst in einem schlechten Holzschnitt noch auf seine geistigen und charakterlichen Grenzen hin. Sein schier beißend scharfer Verstand, seine schier animalische Geschicklichkeit gingen nicht mit der großen, unbewußten Herzlichkeit der Welthelden einher. Er war nicht ungezwungen, nicht großzügig, nicht weltgewandt, nicht einmal freundlich; seine Freude lächelte kaum, oder das Lächeln war nicht breit genug, um zu überzeugen; in seinem Wesen gab es weder Brachen noch prähistorische Küchenabfälle, aber alles war bis zu einem gewissen Grade verfeinert und geschärft. »Er war für keinen Beruf ausgebildet«, sagte Emerson; »er heiratete nie; lebte allein, ging nicht zur Kirche, wählte nicht, weigerte sich, dem Staat Steuern zu zahlen; er aß kein Fleisch, trank keinen Wein, rauchte nie Tabak; und wiewohl Naturkenner, benutzte er weder Falle noch Gewehr. Bei Tisch gefragt, welche Speise er wünsche, erwiderte er, ›was am nächsten steht‹.« So viele negative Vorzüge geraten leicht in den Ruch von Dünkel. Aus seinen Spätwerken tilgte er die lustigen Stellen, in der Meinung, sie seien unter der Würde seiner moralischen Denkungsart; und da sehen wir den Dünkling stehen, öffentlich und offenbart. Es war, bemerkt Emerson scharfsinnig, »viel leichter« für Thoreau, nein statt ja zu sagen; und dieser Charakterzug beschreibt den Mann. Es ist nützlich, nein sagen zu können, doch das Wesen der Liebenswürdigkeit besteht sicherlich darin, ja zu sagen, wann immer es möglich ist. Einem Menschen, der sich nicht selbst verabscheut, wenn er genötigt ist, nein zu sagen, fehlt etwas. Und diesem geborenen Dissidenten fehlte viel. Er hatte geradezu erschreckend wenige Fehler; er hatte nicht genügend viele, um dem Menschlichen völlig entgegengesetzt zu sein; ob man ihn Halbgott oder Halbmensch nennt, er war gewiß keiner von uns, denn er hatte nicht das geringste Gefühl für unsere Schwächen. Die Helden der Welt haben im geräumigen Theater ihrer Naturanlagen Platz für alle positiven Eigenschaften, sogar für solche, die ehrenrührig sind. Sie können viele Leben leben; während ein Thoreau bloß eins leben kann, und auch dieses nur mit ständigem Vorbedacht.
Er war kein Asket, eher ein Epikureer der vornehmeren Art; und er hatte dieses eine große Verdienst, daß er insofern Erfolg hatte, als er glücklich war. »Ich liebe mein Schicksal zuinnerst und zuäußerst«, schrieb er einmal; und sogar, als er im Sterben lag, hier das, was er diktierte (denn offenbar war er schon zu schwach, um die Feder zu führen): »Sie fragen besonders nach meinem Befinden. Ich vermute, daß ich nicht mehr viele Monate zu leben habe, aber natürlich weiß ich darüber nichts. Ich darf sagen, daß ich das Dasein wie eh und je genieße und nichts bedauere.« Nicht jedem ist es vergönnt, die Süße seines Schicksals so klar zu bezeugen, und auch keinem ohne Mut und Klugheit; denn diese Welt ist nur ein jammervoller, unwohnlicher Ort, und dauerhaftes Glück, zumindest für den Selbstbewußten, kommt nur von innen. Nun war Thoreaus Zufriedenheit und Lebensbegeisterung sozusagen eine von ihm mit weiblicher Fürsorglichkeit gegossene und gepflegte Pflanze; denn ein Leben, das ohne Schwung und Freiheit verläuft und vor der kraftspendenden Berührung mit der Welt zurückscheut, hat leicht etwas Unmännliches, fast Memmisches. Mit einem Wort: Thoreau kniff. Er wollte nicht, daß ihm unter seinen Mitmenschen die Tugend abhanden kam, und verdrückte sich in eine Ecke, um sie für sich zu horten. Um ein paar tugendhafter Schwelgereien willen gab er alles auf. Er hatte wahrlich noble Neigungen; seine herrschende Leidenschaft war, von der Welt unentdeckt zu bleiben; und daß all seine Hochgenüsse von derselben gesunden Ordnung waren wie kalte Bäder und frühes Aufstehen. Doch der Mensch kann beim Streben nach Güte auch kalt-grausam und beim Streben nach Gesundheit sogar krankhaft sein. Ich finde jetzt nicht die Stelle, wo er seine Kaffee- und Teeabstinenz erläutert, aber ich glaube, den Inhalt hinzubekommen. Dies ist er: Er hielt es für unökonomisch und eines wahren Empiristen für unwürdig, das natürliche morgendliche Entzücken durch derart schmutzige Genüsse zu verderben; man lasse ihn nur den Sonnenaufgang sehen, und schon sei er auf die Mühen des Tages hinlänglich eingestimmt. Das mag ein guter Grund sein, sich des Tees zu enthalten; aber wenn wir feststellen, daß derselbe Mensch, aus denselben oder ähnlichen Gründen, sich beinahe all der Dinge enthält, die seine Nachbarn unschuldig und vergnügt benutzen, und dazu auch der Schwierigkeiten und Prüfungen der menschlichen Gesellschaft, erkennen wir jene hypochondrische Gesundheit, die heikler als Krankheit ist. Ein Zustand künstlicher Ertüchtigung verdient nicht unsere Achtung. Shakespeare, dürfen wir uns vorstellen, konnte seinen Tag mit einem Krug Bier beginnen und doch den Sonnenaufgang wie Thoreau genießen und diesen Genuß in weitaus besseren Versen feiern. Wer sich, um glücklich zu sein, von den Gepflogenheiten seiner Nachbarn trennen muß, ist in vielem derselbe Fall wie einer, der dazu Opium braucht. Wir aber wollen einen sehen, der kühn in die Welt hinauszieht, ein Mannestagewerk verrichtet und sich dennoch seine ursprüngliche, reine Daseinsfreude bewahrt.
Thoreaus Fähigkeiten paßten zu seiner moralischen Schüchternheit; denn es waren samt und sonders Feinfühligkeiten. Er fand sich in finsterster Nacht vermöge seines Fußtastsinns im Wald zurecht, er konnte Strecken durch Abschreiten exakt abmessen und Rauminhalte mit dem Auge schätzen. Sein Geruchssinn war so fein, daß er die Ausdünstungen der Wohnhäuser wahrnahm, die er nachts passierte; sein Gaumen war so unverbildet, daß er, gleich einem Kinde, den Geschmack von Wein als widerlich empfand – oder, da in Amerika zu Hause, vielleicht nie etwas Gutes gekostet hatte; und sein Naturwissen war so vollkommen und seltsam, daß er anhand der Pflanzen das Datum des Jahres fast auf den Tag genau bestimmen konnte. Im Umgang mit Tieren war er das Urbild von Hawthornes Donatello. Das Waldmurmeltier zog er am Schwanz aus seinem Bau; der Fuchs suchte Schutz bei ihm; in seine Weste schmiegten sich wilde Eichhörnchen, wie man gesehen haben wollte; er steckte den Arm in einen Teich und holte einen glänzenden, nach Luft schnappenden Fisch heraus, der unerschrocken auf seiner flachen Hand lag. Es gab nicht viel, was er nicht konnte. Er baute ein Haus, ein Boot, machte Bleistifte und Bücher. Er war Vermesser, Gelehrter, Naturgeschichtler. Er konnte laufen, wandern, klettern, Schlittschuh laufen, schwimmen, Boote lenken. Der geringste Anlaß genügte ihm, seine Körpertüchtigkeit hervorzukehren; und ein Fabrikant, der bloß sein geschicktes Hantieren an einem Waggonfenster sah, offerierte ihm sofort eine Stellung. »Der einzige Gewinn vielen Lebens«, bemerkt er, »ist die Fähigkeit, Unwichtiges besser zu machen.« Doch seine Sinne waren derart genau, er war in allen seinen Fasern derart lebendig, daß diese Maxime für ihn anscheinend geändert werden mußte, denn er machte das meiste mit seltener Vollendung. Und vielleicht betrachtete er sich selbst mit Wohlgefallen, als er schrieb: »Obwohl die Jungen letztlich gleichgültig werden, sind die Gesetze des Universums nicht gleichgültig, sondern stets auf der Seite des Empfindsamsten.« […]
SINN UND FORM 4/2014 S. 480-500, hier S. 480-482