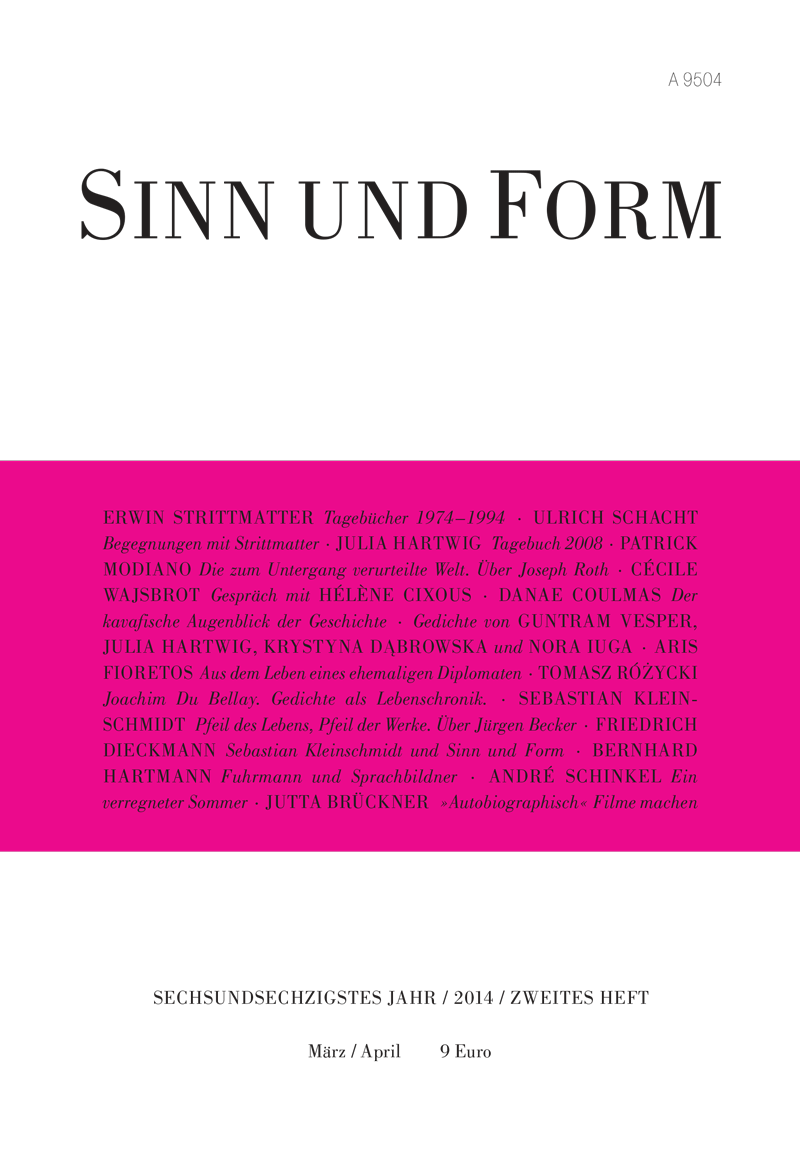Leseprobe aus Heft 2/2014
Kleinschmidt, Sebastian
DER PFEIL DES LEBENS UND DER PFEIL DER WERKE
Laudatio zum Günter-Eich-Preis auf Jürgen Becker
Der polnische Dichter Adam Zagajewski hat vor vielen Jahren ein langes, wehmütiges Gedicht mit dem Titel »Elektrische Elegie« geschrieben. Es beginnt so:
___Leb wohl, deutsches Radio mit dem grünen Auge,
___du schwere Kiste, zusammengesetzt – fast –
___aus Körper und Seele (deine Lampen glühten
___lachsfarben, rosig, wie das tiefe Ich
___bei Bergson).
______Durch den dicken Stoffbezug über dem
___Lautsprecher (mein Ohr preßte sich an dich wie ans
___Gitter des Beichtstuhls) hatte einst Mussolini
______________________________geflüstert,
___Hitler geschrien, Stalin etwas ruhig erklärt,
___Bierut gezischt, Gomulka ohne Ende geredet.
___Dennoch wirft dir niemand Verrat vor, Radio,
___nein, deine einzige Sünde war der unbedingte
___Gehorsam, die zärtliche Treue zu den Megaherzen:
___Wer kam, wurde gehört, wer sendete –
___empfangen.
Zagajewskis Großvater war Germanist, er besaß einen Rundfunkapparat. Von diesem deutschen Erbstück erzählen die Verse.
Auch Jürgen Becker könnte vom Radiohören erzählen, ebenso elegisch, ebenso erinnerungstreu. Und er hat 2003 in »Schnee in den Ardennen« davon erzählt: »Jetzt sind es vier Jahrzehnte her, daß ich die beiden Kammern bezog, die früher der Heuboden waren. Manchmal drehte ich abends am Radio, ein kleiner cremefarbener Philips, eines der ersten Nachkriegsgeräte. Einmal blieb ich im Bereich der Langwelle, wo sonst keine Sender zu empfangen waren, an einer weiblichen Stimme hängen, die Zahlen aufsagte, in unregelmäßiger Reihenfolge, vorwärts und rückwärts, zwischen eins und zehn. Es war eine merkwürdig tonlose Stimme, die mechanisch, fast maschinenhaft in einem gleichbleibenden Rhythmus sprach. Auffallend war, daß sie die Zahl fünf mit einem eingefügten e artikulierte: fünnef. Irgendwann brach die Stimme ab, und man hörte nur noch das kaum merkliche Rauschen des Nichts, das am Ende der Skala beginnt. Mehrere Abende lang, in der Stunde vor Mitternacht, wartete ich auf die geheimnishafte Stimme, die sich nicht regelmäßig meldete; dann wohnte ich wieder woanders und dachte nicht mehr daran.«
Ist das nicht auch eine elektrische Elegie? Nur diesmal in erzählender Prosa, doch nicht weniger poetisch.
Der Rundfunk, gab Jürgen Becker einmal zu Protokoll, habe ihn seit Kindertagen begleitet, zuerst als Problem in der Ehe seiner Eltern. Seine Mutter war lebensfroh, hörte gern Musik und wünschte sich immer ein Radio. Sein Vater, ein unmusikalischer Mensch, konnte damit nicht viel anfangen. Er erzählte ihm eine Anekdote aus den zwanziger Jahren: Im Haus der Schwiegereltern, in dem seine Eltern wohnten, war es üblich, daß man abends zusammensaß und plauderte. Als der Schwiegervater sich ein Radiogerät zulegte, hörten die Gespräche auf. Plötzlich saß alles um den Apparat herum, die Sendungen waren damals noch schwer zu verstehen. Keiner durfte in der Kaffeetasse rühren, weil das Krach machte. Für seinen Vater sei diese Erfahrung ein Schock gewesen: das Ende der Gespräche.
Das hätte auch eine Urszene in Jürgen Beckers Biographie sein können. In seinem Buch »Im Radio das Meer« steht der Satz: »Seine Kindheit war eine Schule des Schweigens. Vielleicht, sagt er, ist das der Grund, warum er nie habe richtig erzählen können.« Aber könnte man nicht in der Schule des Schweigens auch eine Schule des Hörens sehen? Was wir aus Beckers Werk kennen, das Klangkino der Sprache, die akustische Landschaft, den Hall und Schall der Geschehnisse, Facetten aus der Geschichte der Geräusche, Stille und Sprechen, die Vielstimmigkeit, in uns und außer uns, Stimmen aus der Ferne, Stimmen, die sich widersprechen, den schönen Vers »die Richtung des Windes entscheidet, / welchen Geräuschfilm die Nacht durchs Zimmer zieht«, all das war, ehe es durch die Avantgarde der fünfziger und sechziger Jahre eine Bestätigung fand, bereits den Erlebnissen des Kindes inskribiert, es war, bevor es Einzug hielt in Jürgen Beckers Schreiben, zu einer sein Bewußtsein prägenden Selbsterfahrung geworden.
Und das nicht nur auf die Familie bezogen. Im Interview erzählte er, daß er als kleiner Junge intensiv das Kriegsgeschehen verfolgte. Es kamen ständig Sondermeldungen mit den Siegen der Wehrmacht. Das Radio lieferte ihm die Kriegsberichterstattung. Da gab es Berichte von der Front mit Kampfgeräuschen, heulenden Stukas, die er fasziniert hörte. Zugleich hatten sie den »Drahtfunk«, der über den Telefonanschluß lief. Der für Thüringen zuständige Sender informierte dort über die Luftlage; sie erfuhren also, wo ein feindlicher Bomberverband im Anflug war. Der Drahtfunk, erinnert er sich, »war geisterhaftes Radio. Man hörte erst ein merkwürdiges tickendes Geräusch und dann die monotone Stimme der Sprecherin. Natürlich habe ich auch die sogenannten Feindsender entdeckt. Als ich eines Abends am Radio spielte, fand ich sogar zwei dieser Sender: BBC London und Radio Luxemburg. Da bekam man Meldungen mit, die man im großdeutschen Rundfunk nicht hören konnte. Ich konnte diese Sender nur heimlich hören, mein Vater durfte es nicht erfahren. Mein Vater hörte aber auch heimlich, was ich wiederum nicht wissen durfte […] Mein Verhältnis zum Radio ist früh durch Geheimnisse und Verbotenes bestimmt worden.«
Die Welt des Hörspiels tat sich damals für den Heranwachsenden noch nicht auf. Das geschah erst nach dem Krieg, Anfang der fünfziger Jahre, als er wieder in Köln war. Jetzt kam es auch zur Begegnung mit den Hörspielen von Günter Eich. Zu einem Gedenkbuch für ihn hat Jürgen Becker 1973 ein Gedächtnisgedicht beigesteuert. Es vergegenwärtigt eine Frühstücksszene in der Westberliner Akademie der Künste. Zeilen aus Eichs Versen und Satzfragmente aus dem Gespräch mit ihm durchziehen den Text. Das Gedicht offenbart Respekt und Distanz und auch etwas von dem, was Sibylle Cramer später ein Gegenprogramm genannt hat.
Vom Hörspiel war in dem Gedicht nicht die Rede. An anderer Stelle aber hat sich Becker auch zum Radioautor Eich geäußert: »Wenn ich von Günter Eich gelernt habe, welche Kraft der Imagination dem Hörspiel eigen sein kann, dann habe ich zugleich gelernt, daß es nicht unbedingt nötig ist, dem Hörspiel eine Szene, eine unsichtbare Bühne einzurichten, sondern es allein im sprachlichen Vorgang entstehen zu lassen.« Auch hier Respekt und Distanz, auch hier ein Stück Gegenprogramm.
[...]
SINN UND FORM 2/2014, S. 256-264, hier S. 256-258