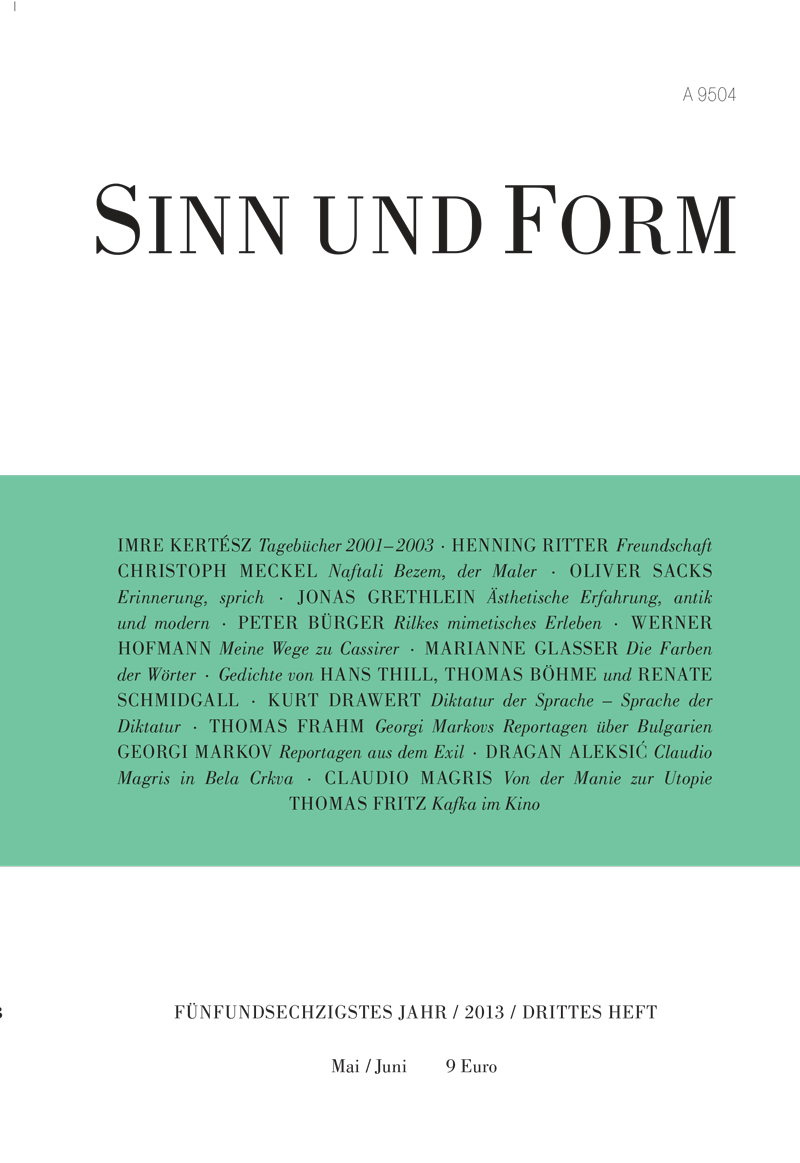Leseprobe aus Heft 3/2013
Meckel, Christoph
Naftali Bezem, der Maler
Als ich Naftali Bezem zum erstenmal besuchte, hatte er neun oder zehn Jahre in Basel verbracht, in kaum nachvollziehbarer Weise wie in Verbannung allein, private Isolation, die keinen politischen Anlaß, keine künstlerische Notwendigkeit zu erkennen gab. Er arbeitete und wohnte in einem Backsteinkomplex voller Werkräume, Ateliers und Büros, nicht weit von der Rheinpromenade auf der Kleinseite Basels. Sein Studio und Privatraum war grau vom Nordlicht und Durcheinander der Dinge. Er hatte immer Zeit, war immer allein, gedrungene Gestalt, schwer beweglich, prallbäuchig, leicht schwankend auf krummen Beinen, Sancho Pansa ohne Maultier und Don Quichote, vogeläugig, scharf blickend, in charmanter und heftiger Weise gesprächig, sein Lachen war Spott und Gelächter, leise, halblaut, laut, und war ein Auslachen, krähende, krächzende Ironie. Naftali, der Kurzgewachsene, schien sich zu amüsieren, wenn großen Männern, prachtvollen Gestalten ein Pech passierte, wer in den Dreck flog, bekam seinen Frohsinn zu spüren. Es geschah ohne Bösartigkeit, es war sein Spiel, bescheidene Gerechtigkeit, die Naftali für sich beanspruchte, durchtriebene Unschuld eines Bucklicht Männleins, in Gestalt eines schwerbeladenen alten Juden.
Es war Asher Reich, der mich auf Durchreise aus der Innerschweiz anrief und in rauhem, jiddisch-anarchischem Straßendeutsch beschwor: Besuch ihn, besuch ihn! Er kennt dich! Und ich: Wie kann er mich kennen, ich kenne ihn nicht. Und Asher: Hat er was gesagt von Moèl – kennst du nicht Moèl? Ich schrieb an den unbekannten Naftali Bezem nach Basel, schickte eine Radierung des Zyklus Moèl, der 1959 veröffentlicht worden war, und erhielt von ihm daraufhin eine Monographie seiner Malerei und eingelegt eine Lithographie mit den Zeilen: »Lieber Christoph, Danke für Deinen Moèl und den beigefügten Brief. Ich freue mich auf Dein Besuch, alles Gute, Dein Naftali der Dich immer gesucht hat.« Ein paar Tage später fuhr ich zu ihm nach Basel.
Badischer Bahnhof – neben den dunklen, alten Bahnhofshallen Paris – Gare du Nord, Gare d’Austerlitz, Gare de Lyon – die mir von Kind an vertraute, persönliche Station Europas. Durch den Badischen Bahnhof her und hin war mir Zukunft, Hoffnung, Freundschaft entgegengekommen wie nirgends sonst, hier konnte ich Deutschland verlassen, wann immer ich wollte, und mit ganz anderen Leuten sorglos sein. Asher Reich hatte mitgeteilt, daß DIE KUNST VON NAFTALI bedeutend in Israel sei und die offenbar bekannteste weltweit seit Gründung des Staates. Sie dekorierte die Eingangshalle des Präsidentenpalastes in Jerusalem und als Metallrelief – mit der Allegorie des judaischen Löwen – den Vorraum von Yad Vashem.
*
Wenn ich einen halben oder ganzen Tag bei ihm in Basel gewesen war, fuhren wir am Abend mit der Tram zum Badischen Bahnhof, Naftali begleitete mich durch lange, hallende Gänge, an nicht mehr besetzten Zoll- und Kontrollkiosken vorbei auf den Bahnsteig und wartete mit mir in einem Cafeteria-Container auf meinen Zug. Seine kleine, massive Gestalt blieb winkend im Zwielicht der Halle zurück, sein Gesicht schien von Ernst verschlossen, er lächelte nicht.
Bahnhöfe machten auf ihn einen starken Eindruck. Ungewißheit schien ihn zu befallen, die eigene Neugier befremdete ihn, er sprach halblaut, verstummte, hielt sich mit kurzen Schritten an meiner Seite, und ich verspürte in ihm Befürchtung und Zweifel. Etwas Nichtgeheures hinderte ihn, sich allein in Bahnhöfen aufzuhalten.
Ich holte ihn mit dem Wagen in Basel ab, brachte ihn durch das Markgräflerland auf Nebenstraßen nach Freiburg, zeigte ihm Orte und Häuser, die ich kannte, brachte ihn an den Abenden zum Zug nach Basel, besorgte sein Ticket – er selbst schien außerstande, ein Ticket zu kaufen –, blieb auf dem Bahnsteig zurück und winkte, wie er in Basel zurückblieb und winkte. Spät in der Nacht wurde telefoniert und mit Genugtuung festgestellt, daß er ohne Probleme durch den Badischen Bahnhof und danach mit der Tram und zu Fuß nach Hause gekommen war.
Als ich ihn einmal bitten mußte, allein mit dem ICE nach Freiburg zu fahren, löste die Bitte in ihm Erschrecken aus. Wie einem angstvollen, kopfscheuen Kind mußten ihm in endlosen Telefonaten die Unsicherheit und die Furcht genommen werden. Mit dem ausgesuchten ICE kam er nicht an. Er hatte sich auf einen falschen Bahnsteig verirrt und war in einem REGIONALEXPRESS von einer kleinen Station zur nächsten, zwei ungewiß endlose Stunden nach Freiburg getuckert worden. Unglücklicher, erleichterter Naftali, entgeisterte Augen. Es waren wohl nicht nur die Bahnhöfe und die Züge. Um sich in Deutschland orientieren zu können, brauchte er, schien mir, die Gegenwart eines Menschen, der ihm vorausging in einer Schneise.
*
Sulzburg, eine kleine, einstmals christlich-jüdische Landstadt in den Vorbergen des südlichen Schwarzwalds. Ich wollte ihm den Jüdischen Friedhof zeigen, wir fuhren im Wagen hin. Er liegt in alt vorgeschriebener Entfernung vom Ort an einem Berghang im Mischwald, ein starker Bergbach strömt vorbei. Vor dem Friedhofstor wurde ein Campingplatz eingerichtet. Man durchquert ihn zu Fuß, um in den Friedhof zu kommen.
Entlang einer steilen Treppe aus schiefen Steinen, auf mehreren Terrassen vergrast und verfallen im Zwielicht, steigt der Grabsteingarten – einstmals ein Totenpark – hoch in den Wald und verliert sich unter bemoosten Bäumen. Die Schriften der ältesten Gräber sind nicht zu entziffern, die Steine grün und schwarz von Moder, versinken in Erde und Laub. Es gibt keine Steine mehr auf den Böden des Friedhofs, sie liegen in Haufen und einzeln auf den Gräbern. Stimmen der Vögel, wenn das Camping außer Betrieb ist, tiefe Ruhe. Eine neue Stele in der Nähe des Eingangs trägt die Inschrift: »Den Opfern der Judenverfolgung von 1933–1945 gewidmet und dem Gedenken der Juden von Sulzburg und Staufen, die schutzlos preisgegeben den Tod für ihren Glauben erlitten.« (1970)
Hier wurden Mitte der dreißiger Jahre die letzten Toten der Jüdischen Gemeinde beerdigt. Aus Sulzburg stammte Gustav Weil, ein Jude, der das Gegenteil eines Juden sein wollte, Arabisch lernte, in Kairo lebte und als erster die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht vollständig ins Deutsche übersetzte. Das Leben der Juden, die mit den Christen gemeinsame Arbeit – der Wein, das Vieh, das Holz und ein Bergwerk – wurden rabiat und schnell zerschlagen, die Juden nach Gurs deportiert.
Ich sagte: – die den Tod für ihren Glauben erlitten und das Camping vorm Friedhof, das ist deutsche Kultur.
Naftalis Lachen war unfroh, doch schien dieser Satz ihn kaum zu erreichen. Wann warst du zum letztenmal auf einem Jüdischen Friedhof? Er gab keine Antwort, stieg schnell, ohne Vorsicht die steilen, schiefen Stufen hinauf, verschwand im Halbdunkel zwischen Gräbern und Sträuchern, kam dann langsamer, doch ohne Vorsicht die Stufen wieder herunter, stand zwischen Gräbern und starrte mich an, als wüßte ich nichts von diesem Ort. DAS IST DOCH, WOHER ICH KOMME! Ein geflüsterter Ruf, ein Schrei.
Naftali, der gern im Auto lachende, rücksichtslos schwadronierende Ausflügler war während der Weiterfahrt still. Monate später sagte er: ich kann den Ort nicht vergessen.
*
In seiner Wohnung in Basel sah ich Fotografien seiner Frau Hannah an der Wand, andere nahm er aus Büchern, Mappen und Kästen, die er, am Tisch sitzend, mit der ausgestreckten Hand erreichen konnte. Hannah war eine große, schöne, sportlich trainierte Frau. Er hatte als Lehrer für Kunst und junger Dozent auf Zypern und in Tel Aviv mit ihr zusammengearbeitet. Sie war eine Tochter russischer Immigranten der ersten Generation von Einwanderern. Er selbst sah sich als EINEN DER LETZTEN, DIE DORT – in Europa – GEBOREN UND NACH EREZ ISRAEL GEKOMMEN WAREN. Nach der Geburt ihres zweiten Sohns wurde PARKINSON bei ihr diagnostiziert. Naftali brachte sie nach Deutschland, in ein Klinikum in Freiburg. Eine Operation, die nicht wiederholt werden konnte, rettete ihr Dasein für zehn Jahre.
In einer kleinen Buchhandlung in der Salzstraße in Freiburg entdeckte Naftali die Bildergeschichte des Moèl, die ich 1958 gezeichnet, 1959 veröffentlicht hatte. Er kaufte das Buch, nahm es überall hin mit, nach Israel, nach Paris und zuletzt nach Basel. Er liebte Moèl und den Fisch und brauchte sie. Bei meinem ersten Besuch zeigte er mir das alte Exemplar voll von Flecken und Eselsohren.
BEHOLD! I DO NOT GIVE LECTURES, OR
A LITTLE CHARITY: WHEN I GIVE,
I GIVE MYSELF.
(Walt Whitman)
»Dies ist die Geschichte von Moèl und seinem Fisch, sie ist in der Bildersprache geschrieben. Vor Zeiten ging es Moèl gut, er lebte angenehm. Aber das Angenehme brachte ihm nichts ein, das Unbekannte lockte aufzubrechen. Da machte sich Moèl an sein Leben schwarzen Glücks.
Seine Tage sind nicht gezählt, und er besitzt nichts außer seinem Fisch; er ist weder arm noch reich und steht in niemandes Dienst. Es geht ihm besser als dem Bauern Sancho Pansa, der sich bitter beklagt, daß er das von Don Quichote versprochene Königreich nie bekommen hat, denn Moèl ist nie etwas versprochen worden, nicht einmal ein verwilderter Rübenacker. Daher wird Moèl nichts fordern oder erwarten, aber alles erobern und sich anverwandeln, was er an Welt und ihren wechselnden Bildern findet. Er wird durch die Länder und Labyrinthe, Bestürzungen und Niederlagen, Tollheiten und Schwänke bis an die großen Seen der Träume kommen. Er wird Licht und Schatten queren und ein König heimlich gesicherter Schätze sein, für die man keine Häuser baut, und er wird reich sein in dem Bemühen, ohne Fesseln zu leben.
Unterwegs hat Moèl manchen Freund gefunden. Er lacht, wenn der eine von ihnen in einer Bretterbude überm Abgrund balanciert und sein Stöckchen schwenkt. Er erinnert sich auch, mit manchem unentbehrlichen Taugenichts auf derselben Landstraße getippelt zu sein. Er hat mit dem, der die Welt entsetzlich fand und sich dafür bedankte, ein paar Zwischenblicke des Einverständnisses ausgetauscht. Er ist dem, der sein Gauklergewand zerfetzte, an den Ecken zugiger Boulevards begegnet. Und einmal hat er einen Mann das Lied von der Freundlichkeit der Welt singen hören; das hat Moèl nicht mehr vergessen können.
Hellwach schlafwandelt Moèl von einem Land in das andere. Was er erlebt ist unwirklich, aber wahr. Er füllt, was er leer findet, und leert das Volle. Er erfährt, daß weder sein Schatten, sein Fisch noch sein Traum, weder sein Schuh noch seine schöne Magelone wirklich ihm gehören, und er richtet sich darauf ein. Er nimmt sein Leben in die Hand und geht brüderlich mit ihm um. Er liebt es und tut alles, um es instand zu halten. Er schuldet ihm nichts, das hofft er.
Man wird ihn foltern, erniedrigen und um jegliche Würde bringen. Man wird ihn das Fürchten lehren. Zorn, Erschöpfung und Grimasse, das Große Gelächter und der letzte Schmerz werden ihn treffen. Aber man wird ihn nicht vernichten können. Moèl, geschunden, zerschlagen und betäubt, wird von neuem zu leben anfangen.«
Naftalis Fisch ist Gegenstand der Malerei, Geschwistergeschöpf des Moèl, jüdisches Lebewesen und Symbol, das über die Kraft der Verwandlung verfügt. Er kann als Luftgestalt erscheinen, als Flucht- und Flugtier, befrachtet mit Zauberzeug und Kram des Lebens. Er hat eine Zunge und schreit.
[...]
SINN UND FORM 3/2013, S. 325-329