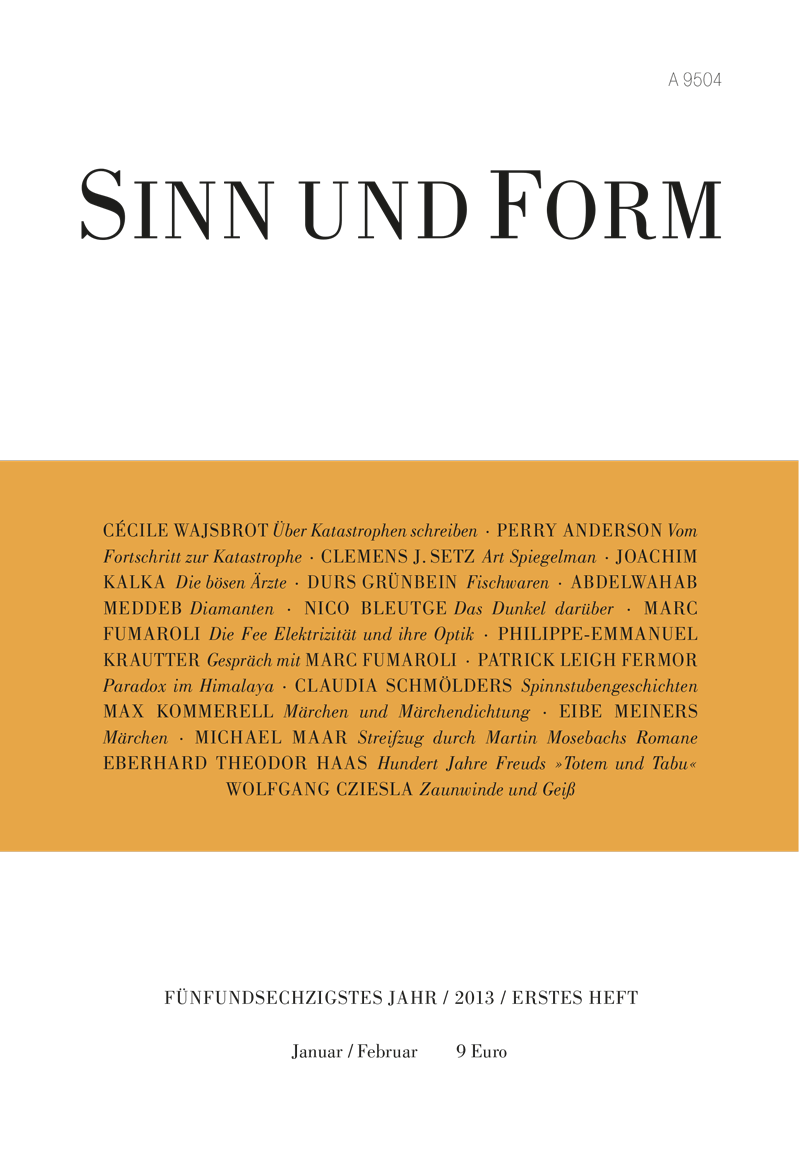Leseprobe aus Heft 1/2013
Fumaroli, Marc
Die Fee Elektrizität und ihre Optik
Elektrizität hatte zu Napoleons Zeit eine ähnliche Bedeutung wie das Christentum unter Tiberius. Allmählich zeichnete sich ab, daß diese allgemeine Innervation der Welt folgenschwerer sein und das künftige Leben tiefgreifender beeinflussen würde als alle politischen Ereignisse von Ampère bis heute.
Paul Valéry
Die Nachfahren Talbots, Daguerres und der Brüder Lumière, diese glücklichen Zwerge auf den Schultern großer Entdecker, sehen sich als Erben und Privatiers der jüngst durch das Internet noch verstärkten und beschleunigten Bilderfluten: Wir fahren die reiche Ernte der Saaten unserer Urgroßväter ein, der Erfinder, ersten Konsumenten und Multiplikatoren der von Herschel als Lichtmalerei, Photographie, bezeichneten Technik (in Abgrenzung von der Schattenmalerei, der Skiagraphie antiker Künstler). Damals ging es bloß um Dunkelkammern, in denen sich die Wirkung von Tageslicht auf lichtempfindliche Glasplatten zeigte. Das Kino und erst recht Fernsehen, Computer- und Digitaltechnik konnten nur durch die Verfügbarkeit von Elektrizität aufkommen. Die Welt, die sie uns zeigen, unsere Lebenswelt, ist auf Elektrizität angewiesen und wird im wesentlichen von Lampen, Scheinwerfern und Blitzlichtern erhellt. Eine moderne Apokalypse begänne mit einem allgemeinen Stromausfall. Unser Auge, unsere Sinne, unser Dasein haben sich an künstliches Licht, an seine künstliche Wärme gewöhnt, und wir leben in einem elektrischen Kokon alltäglicher Science-Fiction, die den alten Planeten und sein Licht ersetzt. Die gesamte Prähistorie dieser sekundären Welt und die ihr entstammenden, unter anderer Sonne entstandenen Relikte rühren von einem unvorstellbar archaischen Universum, einer langen Höhlenzeit, deren ursprüngliche Beleuchtung sich allein der »Blick aus der Ferne« phantasievoller Ethnologen und Archäologen noch vorzustellen vermag. Damit dieser Blick dem Kameraauge und unserer elektrischen Optik zuzumuten ist, muß man uns mit technologischen Kniffen darüber hinwegtäuschen, daß die Vergangenheit, jede Vergangenheit, die der Künstler wie die ihrer Kunden, sich bei Tag und bei Nacht unter anderen Lichtverhältnissen abspielte als unser Leben. Der Maler schlechthin, der Schöpfer, der in der Genesis die erhabenen Worte »Fiat lux« aussprach, diese »Sonne der Geister«, wie der Heilige Augustinus ihn nennt, tut sich verständlicherweise schwer, in der von elektrischen Zauberern geschaffenen Kunstwelt der Bequemlichkeit, des Komforts und der Antriebsloigkeit präsent zu bleiben.
Bis ins späte 19. Jahrhundert gingen die Künstler davon aus, die Rezeption ihrer religiösen und weltlichen Bilder erfolge bei Tageslicht – ihrem Gegenstand und zugleich Verbündeten – selbst wenn sie es in ihren Ateliers oder mit Hilfe einer camera obscura einfingen. Das Sonnenlicht, mit dem das Bewußtsein von Morgen und Abend einherging, fand nachts eine Fortsetzung in Form eines anderen natürlichen Lichts, des lebendigen und magischen Scheins brennender Kerzen, Wachsfackeln und Öllampen. Eine ganze Gruppe abendländischer Maler von Luca Cambiaso bis Caravaggio, ter Borch und de la Tour benutzte die öl- oder wachsbrennende Flamme als spirituelles Motiv, das sich von der umgebenden Dunkelheit absetzt, oder gar als Symbol der Gnade, die sich ihren Weg durch die undurchdringliche und dunkle Materie bahnt. Als Erbe einer bis ins alte Ägypten reichenden Tradition verfaßt Swift noch Anfang des 18. Jahrhunderts eine Hommage an die Bienen, die er trotz ihres unscheinbaren Äußeren als Quellen natürlicher Inspiration und Energie darstellt und mit den Musen vergleicht, mit denen wir heute fälschlicherweise unsere Elektrizitätswerke vergleichen würden. Sammelten Swifts Bienen nicht Nektar und Pollen, das Kostbarste, was die Menschen vom Himmel empfingen, die nahrhafte Süße des Honigs und das wohltuende Licht des Wachses? Das Tageslicht mit seinen zahllosen Abstufungen und schillernden Nuancen stand stets für die Gegenwart des Göttlichen in der wahrnehmbaren Welt. Der unsichtbare und unvorstellbare Gott der Bibel offenbart sich hinter dem Schleier der Meteorologie. Und Cézanne empfing seine Besucher mit der Losung der Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts: »Sortons au soleil!« (Gehen wir hinaus in die Sonne!) Ahnte Richard Wagner als erster die Verbannung des Auges ins Kunstlicht, die zu beheben fortan die unlösbare Aufgabe der Kunst sein würde? In der »Geburt der Tragödie« läßt Nietzsche ihn sagen, die Zivilisation (im Sinne Buffalo Bills) werde von der Musik aufgehoben »wie der Lampenschein vom Tageslicht«. Er wußte noch nicht, daß Fernwärme das Holzfeuer und seine tanzenden Flammen verdrängen würde, denen etwas vom brennenden Dornbusch innewohnt, vor dem Moses bedeutet wurde, seine Sandalen auszuziehen. Die stillen Kräfte des Traums und der Phantasie, wachgerufen vom Lodern und Knistern des Holzes, diesem unerschöpflichen, sich ständig erneuernden Schauspiel, wichen dem zapping am Bildschirm, der den offenen Kamin heute ersetzt.
Wir sind derart auf mit Kunstlicht geschaffene und beleuchtete Bilder konditioniert, daß wir Glaswände in Museen und Ausstellungen oft verhängen und Fenster vor dem Sonnenlicht verschließen, um die alten und modernen Bilder mit grellen Scheinwerfern zu beleuchten. Wir tun so, als wüßten wir nicht, daß die Restaurateure hinter den Kulissen alles versuchen, um die alten Bilder wie ihre bei Scheinwerferlicht angefertigten Reproduktionen aussehen zu lassen. Das elektrische Licht ist für uns zur Norm geworden. Das natürliche Licht ist die Ausnahme, die wir unbewußt der Norm angleichen. Jean Baudrillard konnte schreiben, die Städte und Landschaften der Vereinigten Staaten seien riesige, im Studio gebaute Simulakren, die nur auf Scheinwerfer und Kameras warteten. Die Bemerkung ist geistreich, doch wäre es unangebracht, sie nur auf die Vereinigten Staaten zu beziehen. Sie zeigt die Gewöhnung des modernen Auges an die Fotografie, die den Unterschied zwischen der »Amerikanischen Nacht« des Studios und dem hellen Tag selbst nicht wahrzunehmen oder wiederzugeben vermag, die uns in eine für Scheinwerfer und Kameras prädestinierte und präkonditionierte Welt einschließt. Wir haben das elektrische Auge verinnerlicht, das alles, was es erfaßt, irrealisiert und im gleichen Licht vereinnahmt und nivelliert, abstrakt wie ein Objektiv. Es ist ein wissenschaftliches, klinisches Auge, geeignet für Operationssaal, Labor, Fabrik, Gefängnis. Man mußte den Dimmer erfinden, um die spektrale Wahrheit, welche diese Art des Blicks festzuhalten berufen ist, zu verschleiern und zu modulieren, wie das Farbfilter und Photoshop tun. Bei Kunstlicht ist Fleisch nur noch Materie, sind Werke des Geistes und der Hände nur noch Tand. Die nächtliche Neonbeleuchtung von Bussen und U-Bahnen verwandelt deren Abteile in ebensoviele danteske Höllenkreise und mobile Leichenhallen, an denen sich heutige Fotografen delektieren, als passe dieses morbide Aussehen der Lebewesen am besten zu den Linsen ihrer Kameras, die unser natürliches Auge ersetzen.
Das beste uns bleibende Zeugnis des Tageslichts, gewissermaßen sein Museum (sofern man die Bilder in ihrem eigenen Licht ausstellt), sind die unglaublichen Pleinairgemälde der Impressionisten. Man könnte meinen, sie hätten sich, von jenem ahnungsvollen Furor getrieben, der noch Cézanne, Seurat und den Landschaftsmaler Balthus beherrschte, beeilt und angestrengt, in ihren Bildern gerade noch rechtzeitig die Wunder und Geheimnisse einer im Tageslicht wahrgenommenen Welt einzufangen und festzuhalten, ehe der Vorhang fiel und das menschliche Auge umschwenkte, die Natur bei Tag und bei Nacht dem Kunstlicht, dem fotografischen Blick, der Imagination des Kinos angepaßt wurde. Dank dieser letzten, ihrer Rolle bewußten Zeugen können wir noch die Schönheit der Dinge entdecken und schätzen, wenn wir beim Spaziergehen auf sie stoßen, ein klarer Bach, ein Wäldchen, ein kleiner Garten, eine Wiese. Betroffen von der Erinnerung an das, was die Freilichtmaler uns gezeigt haben, sehen wir plötzlich wie sie, wie früher. Diese Offenbarung kommt selten allein: Sobald wir sehen, was uns sonst verborgen ist, bemerken unsere lärmverstopften Ohren, geruchsentwöhnten Nasen und styroporbetäubten Hände auch Vogelzwitschern, Insektengesumm, Glockenschläge in der Ferne, den Gesang der Welt.
Just als die »Fée Electricité«, wie man den Strom in Frankreich gerne nennt, ihre unverzichtbaren und unleugbaren Annehmlichkeiten zu bereiten begann, machten die europäischen Landschaftsmaler dieses Wunder kurz vor seinem Verschwinden noch einmal sichtbar, das jeder, ob arm oder reich, für selbstverständlich gehalten und unbewußt genossen hatte, die festliche Gastfreundschaft der Engel des Tags und der Nacht, die nach den Wesen und Dingen der Welt schmeckt, eine alltägliche Theophanie. Die durch künstliche Beleuchtung geschaffene sekundäre Welt ist bei weitem nicht so egalitär. Hier, unter den Spots, ein Übermaß an Helligkeit, dort Düsternis unter der einzigen nackten Glühbirne, die Picasso in »Guernica« zum Symbol von Weltende und namenlosem Grauen gemacht hat. Es ist auch nicht verwunderlich, daß Monets Werk mehr als jedes andere den Zorn von Bilderstürmern und die Verehrung der nostalgischen Menge auf sich gezogen hat. »Aktionisten«, die impressionistische Bilder zerstechen, ziehen als gute Logiker die letzte Konsequenz aus einer »zeitgenössischen Kunst«, die nicht duldet, daß man abseits von Neonlicht und Kathodenbad lebt. Die Fee Elektrizität kennt nur ein Fest: geblendet von Blitzlichtern und Sunlights, belagert von Schwärmen von Paparazzi mit Menschenleibern und Köpfen aus schwarzem Metall; Stadt, Land und Feld will sie nur gefilmt zur Kenntnis nehmen; im »Zeitgenössischen« hat sie endlich die Kunst gefunden, die sie brauchte, nämlich eine Großkonsumentin von Kilowattstunden, die ohne Schalter nichts ist.
Aus dem Französischen von Andreas Jandl
SINN UND FORM 1/2013, S. 84-87