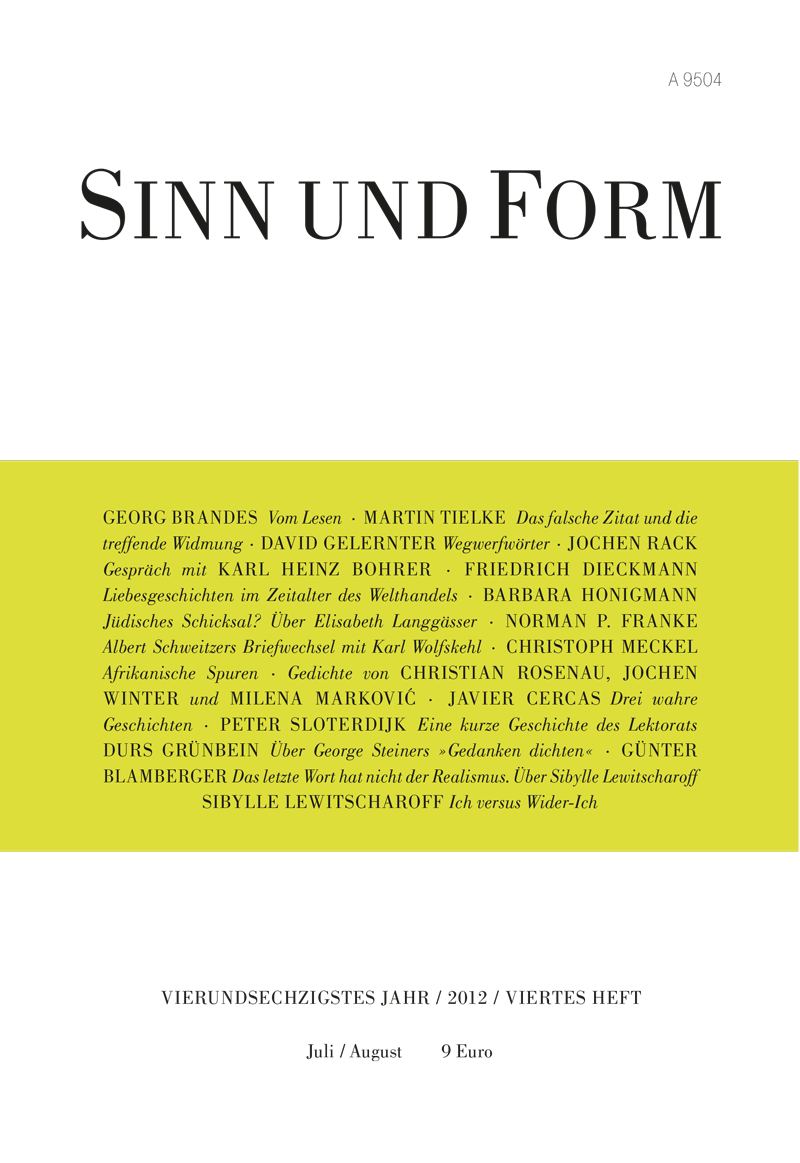Leseprobe aus Heft 4/2012
Tielke, Martin
HABENT SUA FATA LIBELLI ET BALLI
Über das falsche Zitat und die treffende Widmung
Kugeln und Bücher haben ihr Schicksal – dazu gehört,
daß sie zur rechten Zeit treffen und eintreffen.
Ernst Jünger
Der frühe Ruhm des Schriftstellers Ernst Jünger beruht bekanntlich auf den Taten des hochdekorierten Stoßtruppführers im Ersten Weltkrieg, die er in seinem Buch »In Stahlgewittern« beschrieb. Im Verlauf dieses Krieges wurde Jünger vierzehn Mal verwundet und trug, wie er später resümierte, mit Ein- und Ausschüssen zwanzig Narben an seinem Körper davon. Einen der Treffer erhielt er während der Somme-Schlacht. In den »Stahlgewittern« schildert er, wie er im August 1916 zum Einsatz kam und vor einem Haus bei dem Dorf Guillemont von einer Schrapnellkugel ins Bein getroffen wurde. »Mit dem uralten Kriegerruf: ›Ich habe einen weg!‹ sprang ich, meine Shagpfeife im Munde, die Kellertreppe hinab.« Die Kugel war im Unterschenkel steckengeblieben, und da sie glücklicherweise keine Knochen verletzt hatte, war die Sache relativ harmlos. Die Kameraden legten Jünger einen provisorischen Verband an und trugen ihn über die beschossene Straße, wo eine weitere Schrapnellkugel über seine Trage hinwegpfiff, zum vorgeschobenen Verbandsplatz in die Katakomben. Hier kam der Verwundete gleich auf den Operationstisch:
»Während mir der herbeigeeilte Leutnant Wetje den Kopf hielt, schnitt mir unser Oberstabsarzt mit Messer und Schere die Schrapnellkugel heraus, wobei er mich beglückwünschte, denn das Blei war scharf zwischen Schien- und Wadenbein hindurchgefahren, ohne einen Knochen zu verletzen. Habent sua fata libelli et balli, meinte der alte Korpsstudent, indem er mich einem Sanitäter zum Verbinden überließ.«
In älteren Fassungen der »Stahlgewitter« ist der Wortlaut dieser Stelle etwas abweichend, insofern der alte Korpsstudent seinen Ausspruch »schmunzelnd« machte. Dazu hatte er auch allen Anlaß, denn er zitiert mit Habent sua fata libelli zwar ein seit der Antike geläufiges Sprichwort des lateinischen Grammatikers und Dichters Terentianus Maurus, doch die Ergänzung et balli geht nicht auf den lateinischen Philologen zurück und kann überhaupt nicht ernsthaft Anspruch auf korrektes Latein erheben. Weder ist es klassisches noch mittelalterliches Latein, auch kein Kirchen- oder Küchenlatein, sondern eher wohl Korpsstudenten-und Kriegerlatein, das hier aus einem launigen Einfall heraus gebildet wurde. Das Lateinische nämlich kennt das Wort ballum oder ballus nicht, und es scheint sich um einen Neologismus zu handeln, der in Assoziation zu dem jedem Soldaten vertrauten Begriff Ballistik (von dem griechischen βαλλω = mit Geschossen werfen, treffen) gebildet wurde, vielleicht auch – man war schließlich in Frankreich – in Anlehnung an das französische Wort balle (Kugel).
Genauer besehen kann aber von einem Neologismus nicht die Rede sein, setzt dieser doch voraus, daß die Wortbildung Schule gemacht und sich in den Sprachgebrauch eingebürgert hat. Das aber ist bei balli nicht der Fall. Außer im Werk Jüngers tauchen diese Neubildung und ihre Verknüpfung mit dem geflügelten Wort des Terentianus Maurus nirgends auf. Sie geht offensichtlich als eine zufällige Gelegenheitsbildung auf das Konto des Feldarztes. Wie es scheint, hat er den lateinischen Satz nicht nur erfunden, sondern ihn auch in dem Bewußtsein philologischer Inkorrektheit zitiert. Anders ließe sich sein Schmunzeln kaum interpretieren. Jünger jedenfalls war der Ausspruch hochwillkommen, und er gibt ihn um so lieber wieder, als er sich durch die Worte des alten Korpsstudenten in seiner Doppelexistenz als Hommes de lettres und Krieger gespiegelt sieht. Er möchte auch als Soldat im Krieg unter diesem doppelten Aspekt gesehen werden. Ob der Gewährsmann nun richtiges oder falsches Latein sprach, ist ihm dabei egal.
In der Tat war schon der ganz frühe, literarisch noch nicht hervorgetretene Ernst Jünger ein Buchmensch. Am Anfang seiner reichen literarischen Erfahrungen – er war gerade des Lesens mächtig – stand um 1900 das Buch »Robert der Schiffsjunge« von Sophie Wörishöffer, eine Erzählung von Weltreisen auf einem Segelschiff: »Da habe ich angefangen zu lesen und nie wieder aufgehört«, sagte er zu Björn Cederberg. Und der alte Jünger gestand in »Siebzig verweht«: »ich lebe stärker in den Büchern als in unsrer erbärmlichen Wirklichkeit«. Der Bücherkonsum des jugendlichen Jünger war ganz wahllos und so besessen, daß er nachts, da es die Eltern verboten hatten, Licht zu machen, im Stehen das Buch aus dem Fenster hielt, um im Schein der Straßenlaterne lesen zu können. Zwar findet sich in seinem Soldbuch der Fremdenlegion, wohin der achtzehnjährige Gymnasiast ausgerissen war, das Urteil: »Ne sait ni lire, ni écrire«, doch lag dieses Zeugnis vollkommen neben der Realität. Jünger nutzte während seiner Zeit bei der Fremdenlegion jede freie Minute zum Lesen, und als er nach einem mißglückten Fluchtversuch in den Kerker geworfen wurde, suchte er auch in solcher Lage noch lesen zu können, indem er sich eine Lampe konstruierte, »wie ich es aus Casanovas Memoiren gelernt hatte«. Die antike Lampe in seinem Exlibris mag darauf anspielen.
Dieses Gefesseltsein durch Bücher, die ständige Buchlektüre auch in einer dafür denkbar ungünstigen Situation, galt selbst unter den extremen Bedingungen der Frontkämpfe des Ersten Weltkrieges. Angeblich sind die deutschen Soldaten mit Rilke und George im Tornister in diesen Krieg gezogen, was natürlich eine fromme nationale Legende ist. Nicht jedoch im Fall des Leutnants Ernst Jünger. In seinem Marschgepäck befand sich tatsächlich Literatur. Wenn ihm sein Bursche den Tornister packte, stellte der nur »die einzige Frage: ›Welche Bücher sollen diesmal mit?'« Jünger blieb sogar an der Front und während des Kampfes ein Lesender, wann immer sich die Gelegenheit dazu bot: »Ich las auch im Dobschützwald, 1917, während der Pausen, die die Engländer beim Angriff einlegten. Allerdings hatte ich Posten aufgestellt.« Er las im Feld etliche Werke der großen Literatur, wie etwa »Orlando furioso« von Ariost oder Kubins Roman »Die andere Seite«. Unter der ungeheuer massierten Beschießung im »Wäldchen 125« ließ er sich faszinieren von Fontanes »Irrungen, Wirrungen«; während der Schlacht von Bapaume verschlang er Sternes »Tristram Shandy«, und als er hier verwundet wurde, konnte ihn das nur kurzzeitig von der Lektüre abhalten; er setzte sie, kaum aus der Narkose erwacht, im Lazarett fort.
Somit möchte man die Prägung Habent sua fata libelli et balli verstehen als ein Kompliment des Feldarztes an seinen Patienten, der über das Kriegshandwerk hinaus auch noch von anderen, geistigen Dingen wußte und der gleichermaßen in der Welt der Bücher zu Hause war, wie im Umgang mit Gewehr und Handgranate geübt. So verhält es sich jedoch nicht. Die Fassung letzter Hand der »Stahlgewitter«, wie sie in den Sämtlichen Werken vorliegt, wie auch die früheren Fassungen, die den alten Korpsstudenten seinen Spruch mit einem relativierenden Schmunzeln sagen lassen, sind Fiktion. Diese Stelle ist ein Beispiel dafür, wie Ernst Jünger literarisiert. Seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg sind in den »Stahlgewittern« nicht exakt wiedergegeben; das Buch ist kein Protokoll, das die Wirklichkeit eins zu eins schildert, sondern eben Literatur, mit allen Freiheiten der Gattung. Zieht man das noch nicht literarisch bearbeitete originale Kriegstagebuch Jüngers heran, so liest sich das Ereignis überraschend anders:
»Wetje hielt mir den Kopf, während der Oberstabsarzt gleich mit Messer und Scheere an meinen armen Balg ging und mir die Kugel herausschnitt. Dann murmelte er etwas von Fata belli et balli und ich wurde in die tiefsten Schlünde der Katakomben getragen …"
Indem hier die kleine Silbe li wegfällt und aus dem Nominativ Plural libelli der Genitiv Singular belli wird, fällt eine ganze Dimension, nämlich die Beschwörung des Schicksals der Bücher und ihre Verknüpfung mit den Geschossen, weg. Ebenso ist der Bezug auf das geflügelte Wort des Terentianus Maurus nicht mehr erkennbar. Der Feldarzt spricht lediglich von Kriegsschicksal und Kugeln; von Büchern und geistigen Dingen, gar von einer Berufung auf eine antike Autorität, ist bei ihm nicht die Rede. Die Formulierung belli et balli mag ihm vielleicht wegen der phonetischen und semantischen Assoziation eingefallen sein, sie deutet jedenfalls nicht darauf, daß er seinen Patienten vor dem Hintergrund eines Bildungskanons sieht. Der Arzt könnte wohl auch schwerlich eine Anspielung auf die Buchleidenschaft Jüngers gemacht haben, da er davon kaum etwas gewußt haben dürfte. Schon gar nicht konnte er etwas von dem Autor Jünger wissen, der ja erst nach dem Krieg als solcher in Erscheinung trat und dessen Erstlingswerk »In Stahlgewittern« 1920, also vier Jahre später erschien. Die Verbindung von Büchern und Kugeln, die mit der Zitierung des geflügelten Wortes eines antiken Autors unterstrichene Anspielung auf Literatur und Dichtung ist also die eigene Erfindung und spätere Zutat des Schriftstellers Ernst Jünger. Durch Hinzufügung einer kleinen Silbe öffnet er einen neuen semantischen Horizont. Er legt dem Feldarzt nachträglich in den Mund, was er über sich selbst gesagt haben will. Die Worte des Feldarztes sind Selbstbespiegelung des Autors der »Stahlgewitter«.
[...]
SINN UND FORM 4/2012, S. 454-469