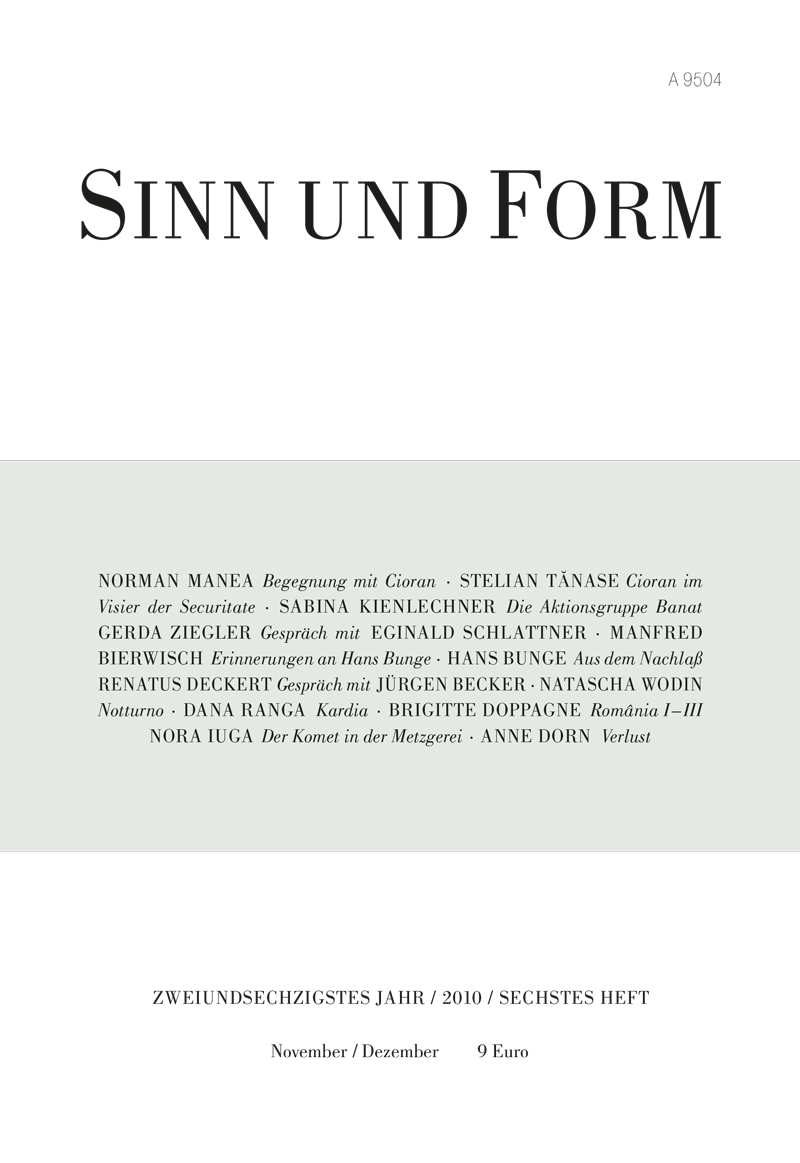Leseprobe aus Heft 6/2010
Bunge, Hans
Aus dem Nachlaß
Deutscher Hans
Um zu erklären, warum gerade ich die Grabrede für Ruth Berlau hielt und warum ich jetzt dieses Buch mit Gesprächen veröffentliche, die ich vor zwanzig Jahren mit Ruth Berlau geführt habe, muß ich etwas ausholen und dem Leser einige autobiographische Details zumuten. Denn die Zusammenhänge sind merkwürdig genug, und die Begegnung zwischen uns war so wenig vorausbestimmbar, als hätten wir in zwei verschiedenen Zeitaltern gelebt. Bis zu meinem dreißigsten Lebensjahr wäre das sogar eine korrekte Aussage.
Der Umstand, daß ich Ruth Berlau – und über sie Bertolt Brecht, Hanns Eisler und andere bedeutende antifaschistische Künstler und Politiker – kennenlernen konnte und mit ihnen zusammen arbeiten durfte, verdanke ich der Niederlage Nazideutschlands im zweiten Weltkrieg, die ich nicht nur nicht erhofft, sondern gegen die ich mich gewehrt hatte, erst aktiv mit der Waffe und dann, indem ich sie lange nicht wahrnehmen wollte. Eine »Kollaboration« mit »Linken«, gar Kommunisten, kam mir bis nach der Kapitulation nicht einmal als Gedankenspiel in den Sinn.
Mein Vater – Korpsstudent mit dem obligaten »Schmiß« einer Mensur, der seine berufliche Laufbahn als Arzt im ersten Weltkrieg begann und sich dann als Zahnarzt in einem Nest bei Dresden niederließ, dort aktives Mitglied des Stahlhelm-Verbandes war, selbstverständlich deutschnational wählte und die Farben der Republik als »schwarz-rot-senf« bezeichnete, einen Kleinkaliberschützenverein gründete und regelmäßig seine Soldatenuniform anzog, wenn er »Stille Nacht, heilige Nacht« unterm Christbaum anstimmte –, mein Vater wäre nicht in der Lage gewesen, mich auf Brecht hinzuweisen. Er wußte nichts von ihm und hätte nichts von ihm wissen wollen. Im Bücherschrank standen statusgemäß selbstverständlich auch Goethe, Schiller, Kleist und Hölderlin, aber besonders stolz war mein Vater auf die vollständige Ausgabe von Karl May, und ich erinnere mich, daß er große Umstände in Kauf nahm, um möglichst schnell an die neueste Krimiproduktion von Edgar Wallace zu kommen.
Meine Mutter war völlig auf ihn eingeschworen. Sie brachte ihm drei Söhne zur Welt, die sie mit turnerischen Übungen abhärtete. Neben ihrer Emsigkeit als Hausfrau – trotz, natürlich, eines Mädchens für die groben Arbeiten, deren Privatleben auf eine durch Vorhänge abgeteilte Ecke unseres Kinderzimmers beschränkt wurde – war das Hervorstechende an ihr, daß sie sich in die Erziehungsfragen aller Familien des Dorfes einmischte, erfolgreich übrigens, weil ihr niemand zu widersprechen wagte, denn sie gehörte dem Kaffeekränzchen der vor Eigendünkel platzenden Hautevolee des Ortes an, wo alles durchgehechelt wurde, was dem Dorf gut oder schlecht bekam. Sie war zudem Schriftführerin des Königin-Luise-Bundes, dem weiblichen Pendant zum Stahlhelm, was sie in ihrer Selbsteinschätzung zu einer heimlichen Thronfolgerin machte. Deshalb gab sie auch nie zu, daß ihr Vater Schuhmacher gewesen war, sondern bezeichnete ihn als Schuhfabrikanten. Ihren Muttertierinstinkt – wir Söhne wurden für [sie] ja nie erwachsen und erhielten wohlgemeinteste Ratschläge bis in unsere Ehen hinein und auch dann noch mitunter eine Ohrfeige –, ihren Muttertierinstinkt bekämpfte sie mit heroischer Selbstverleugnung. Wir wurden alle ins Internat gesteckt, wo die soldatische Erziehung fortgesetzt wurde, ganz im Sinne meiner Mutter. Sie hatte sich eine private Nationalhymne zusammengebastelt, »Lieb Vaterland magst ruhig sein, bei Bunges steht die Wacht am Rhein ...«, und benutzte allen Ernstes die Gleichung: Ein Sohn ist soviel wert wie vier Töchter, weil Söhne ja Soldaten werden dürfen. Wir waren alle drei in Kriegsgefangenschaft und kamen alle drei, früher oder später, aus verschiedenen Himmelsrichtungen zurück. Aber wenn einer totgeschossen worden wäre, weil er in ein fremdes Land eingefallen ist, hätte meine Mutter ihre Tränen zurückgehalten und mit stolzer Bescheidenheit in die Zeitung gesetzt, daß wir »in unabdingbarer Gefolgschaft für Führer, Volk und Reich gekämpft« haben.
Um nicht mißverstanden zu werden: Wir liebten unsere Eltern und hingen an ihnen, trotz Dresche mit der Reitpeitsche, »streng, aber gerecht«. Es war ein normales Leben in der Tradition, antisemitisch und antisozialistisch, so daß wir einen Bogen um den Dorfkonsum machten, in kein Warenhaus gingen, weil der Besitzer doch sicher ein Jude war, und neben dem örtlichen Käseblatt noch den »Alten Dessauer« hielten, benannt nach jenem preußischen Feldmarschall, der den Gleichschritt eingeführt hat und dessen »tägliches Gebet« im Kopf der Zeitung stand: »Lieber Gott, hilf mir heute, oder willst Du nicht, hilf wenigstens den Feinden, den Hunden, nicht!«
Als wir drei Jungen zehn, neun und sechs Jahre alt waren, starb unser Vater, an einem Lungenleiden, aber wer nach der Todesursache fragte, erhielt die schlichte Antwort: an den Folgen des Krieges. Das galt als höherer, ehrenhafterer Tod, und wir konnten als Kriegshalbwaisen herumlaufen.
Der beste Freund unseres Vaters kümmerte sich um die Familie, dann heiratete er unsere Mutter. Er war uns stets wie ein leiblicher Vater, wir liebten und verehrten ihn. Meine Mutter schenkte ihm »aus Dankbarkeit« auch noch einen Jungen. »Zum Dank dafür, daß er so gut zu euch ist«, sagte sie auch später deshalb, weil sie ja nicht gut von unbefleckter Empfängnis reden konnte und fürchtete, wir könnten die Voraussetzung einer Schwangerschaft, den nachweisbar gewordenen Geschlechtsverkehr, für eine Schweinerei halten. Bei dem Übermaß an Prüderie in ihren Anschauungen – und ihrer Erziehung! – war sie sich da selbst nicht ganz sicher.
Durch meinen Stiefvater wurden wir gesellschaftlich aufgewertet, denn er trug eine Uniform, die eines Polizeioffiziers. Kurz vor dem Krieg wurde er als General Kommandeur der Schutzpolizei von Berlin. 1944 wurde er in Zusammenhang mit dem Attentat auf Hitler abgesetzt und verhaftet, aber, weil man ihm nichts Konkretes nachweisen konnte, wieder freigelassen, doch aus der Hauptstadt nach Oberschlesien verbannt. Dorthin kam er aber nicht mehr, weil Oberschlesien inzwischen Kriegsgebiet geworden war. Die Amerikaner brachten ihn auf die Festung Hohenasperg. Er wurde als minderbelastet eingestuft und fand, entlassen, ein Unterkommen als Hilfsarbeiter in einem westfälischen Aluminiumwerk, bis ihm die Nachfolgeregierung des Deutschen Reiches eine auskömmliche Pension zahlte.
Ich achtete meinen Stiefvater später sehr wegen seiner, wenn auch distanzierten, Beteiligung am Widerstand. Vordem hatte ich seine ständigen Auseinandersetzungen mit Himmler und Goebbels eher mit Mißtrauen beobachtet. Ich kann ihm nicht vorwerfen, daß er mich nicht besser informiert hat. Als er mir einmal angewidert von einer Besichtigung des Konzentrationslagers Oranienburg erzählte, ging ich aus dem Zimmer, um nicht zuhören zu müssen. Von Brecht hat er mir allerdings nicht nur deshalb nichts gesagt, weil ich ähnlich reagiert haben könnte. Das lag außerhalb seiner Sphäre.
Erst sehr viel später kamen für mich beide in einen eigenartigen Zusammenhang. Auf dem großen freien Platz zwischen dem Deutschen Theater und der heutigen Reinhardtstraße stand die Karlskaserne. Dort hat mein Stiefvater residiert, bis die Kaserne zerbombt wurde. Heute erinnert kein Stein mehr an sie. Aber an der Reinhardtstraße ist die nur teilweise zerstörte große Turn- und Exerzierhalle, ein Schinkel-Bau, stehen geblieben. Sie wurde 1947 zum Probenhaus des Berliner Ensembles ausgebaut. Hier, wo ich Brecht seit 1953 bei Theaterproben assistierte, hatte mein Stiefvater während des Krieges Polizeikompanien zum Einsatz in der Sowjetunion verabschiedet. Ich habe das nicht miterlebt, aber ich war dabei, als Brecht dort auf Tonband das Gedicht »An die Nachgeborenen« sprach. Als ich später ein Engagement beim Deutschen Theater hatte, war das Probenhaus inzwischen in den Besitz des Deutschen Theaters übergegangen. Es war wieder mein Arbeitsplatz, als gäbe es transzendente Einwirkungen. Wenn ich zum Theater ging, führte der Weg an einem gewaltigen Luftschutzbunker vorbei, der nicht gesprengt werden konnte und zu einem Lager für Kartoffeln und Gemüse umfunktioniert worden war. Das war im Krieg bei Luftangriffen der Befehlsbunker meines Stiefvaters, denn er leitete auch den zivilen Luftschutz in Berlin. Meine Mutter zeigte mir nach Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft gern eine Doppelseite der »Berliner Illustrierten Zeitung«, in der mein Stiefvater als »Kommandeur des Berliner Wunders« in Aktion abgebildet war. Mich rührte es sehr, daß sie die Abstrusität ihres Stolzes nicht begriff. Denn ich muß zugeben, daß ich auch einmal stolz darauf gewesen wäre und daß viel geschehen mußte, bis ich es nicht mehr war.
[...]
SINN UND FORM 6/2010, S. 793-802