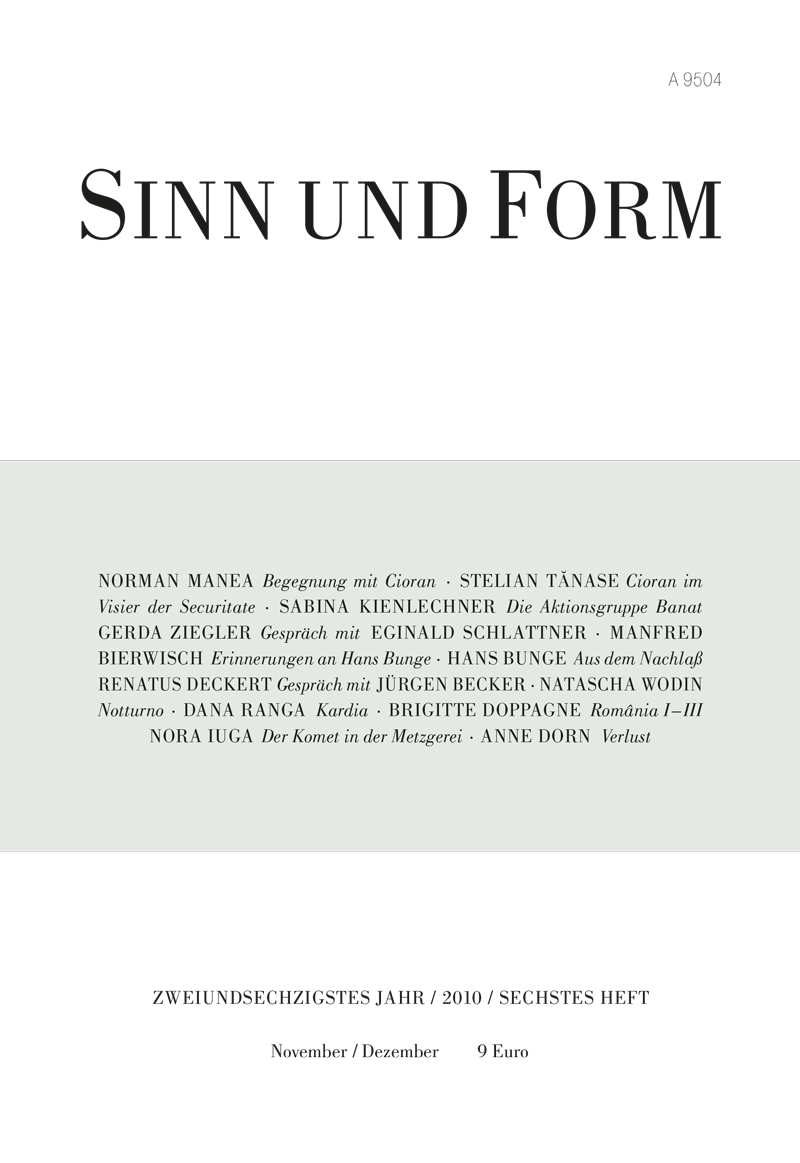Leseprobe aus Heft 6/2010
Manea, Norman
Begegnung mit Cioran
Die Sprache ist die Plazenta des Schriftstellers, dieses Exilanten par excellence. Mehr als jeder »Fremde« im eigenen Land muß sich der Schriftsteller die Sprache langsam oder auch im Überschwang erobern; sie ist ihm Legitimation, geistige Heimstatt. Durch die Sprache fühlt er sich verwurzelt und frei, nur durch sie ist er mit seinen Gesprächspartnern in der ganzen Welt verbunden. Die Sprache verkörpert die wahre Staatsbürgerschaft, den Sinn der Zugehörigkeit – Haus und Vaterland des Schriftstellers. Aus diesem letzten und wichtigsten Zufluchtsort verbannt zu sein, führt zur brutalsten Verstörung, jener »vollständigen Verbrennung« (holo-kaustos), die den innersten Kern der Kreativität berührt.
Ich habe meinen Entschluß, die sozialistische »Strafkolonie« zu verlassen, viel zu lange hinausgezögert, denn ich war kindisch genug mir einzubilden, ich lebte nicht in einem Land, sondern einer Sprache.
Die Befreiung, dies wußte ich, würde die Freiheit selbst beschneiden. Im Dezember 1986 bestieg ich auf dem Bukarester Flughafen das Flugzeug nach Berlin in der Gewißheit, mich auf einen finsteren Handel eingelassen zu haben: Reisepaß gegen Sprache. Daß ich diesen dämonischen Tausch letztlich akzeptierte, sagt wohl genug über die Dringlichkeit, um jeden Preis aus dem »brennenden Bordell« herauszukommen, wie Cioran die Gegend nannte, die er zurückgelassen hatte, ohne ahnen zu können, wie die sozialistische Melange von Bordell, Zirkus und Gefängnis aussehen würde. Mein zweites Exil (diesmal mit fünfzig, nicht mit fünf, wie bei der Deportation nach Transnistrien) gab der Enteignung und dem Legitimationsverlust einen anderen Sinn. Zur Ehre, ein Heimatloser zu sein, kam der Fluch, als Schriftsteller verstummen zu müssen. Trotzdem hatte ich, wie eine Schnecke das Haus, die Sprache mitgenommen. Auch weiterhin würde sie mir erste und letzte Zuflucht sein, infantiler und unwandelbarer Ort des Überlebens.
Deutschland war meine erste sprachliche Heimstatt im Exil. 1987 erschien im Steidl Verlag mein erster im Westen veröffentlichter Prosaband »Roboterbiographie «. Damals hielt ich mich mit einem Stipendium des Berliner Künstlerprogramms des DAAD in Westberlin auf. Die Reise ins Unbekannte hatte unter einem guten Stern begonnen. Das von Angst und Verstörung geprägte Trauma der Dislokation wurde etwas gemildert durch die Vertrautheit mit der deutschen Sprache, die in der ehemals habsburgischen Provinz Bukowina auch im Sozialismus unter meinen Freunden und denen meiner Eltern im verborgenen überlebt hatte. 1987 sollte ich begeistert entdecken, daß diese Sprache in mir nach langem Dämmerschlaf nur darauf wartete, wieder zu erwachen, und dies obwohl ich nur ein Jahr lang systematisch Deutsch gelernt hatte, 1946, in wenigen und längst vergessenen Privatstunden.
Immerhin, es kam auch zu lustigen Begebenheiten. Als meine Frau mich an einem der ersten Berliner Tage Sahne kaufen schickte, suchte ich auf den abenteuerlich bunten Bechern und Dosen des Supermarkts vergeblich nach der Aufschrift »Schmetten«. Schließlich fragte ich die Verkäuferin. Sie schaute mich ratlos an und begriff erst nach mehreren Erklärungsversuchen meinerseits, worum es sich handelte. »Aha, Sahne!« Der österreichische Regionalismus funktionierte in der deutschen Hauptstadt nicht.
Die literarische Konfrontation sollte später erfolgen, in Göttingen, wo ich mit dem Lektor des Steidl Verlags an der Fertigstellung der Übersetzung meines Buches arbeitete. Nachdem wir uns bis nach Mitternacht herumgeplagt hatten, um die bestmöglichen Entsprechungen zu finden, versuchte mich mein massiger Gesprächspartner zu trösten: »Man kann alles übersetzen, das dürfen Sie mir glauben! In Goethes Sprache findet alles seinen Platz! Alles, alles. Auch die ungewöhnlichsten und überraschendsten Sätze können übersetzt werden, das versichere ich Ihnen. Man braucht bloß Talent, Hingabe. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und gewiß auch Geld.«
Ja, Übersetzungen werden auf dem kapitalistischen Markt gewöhnlich schlecht bezahlt. Nicht jeder Schriftsteller kann – wie Günter Grass – den Übersetzern seiner Werke Arbeitstreffen und Erfahrungsaustausch bieten und dies auch finanziell absichern. Als ich erfreut mein erstes auf deutsch erschienenes Buch in Händen hielt, ahnte ich noch nicht, daß weitere folgen würden; auch daß meine Beziehung zu Rumänien nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur noch spannungsreicher würde und sich mein literarischer Status allmählich in den eines »übersetzten Schriftstellers« verwandeln sollte, konnte ich mir damals noch nicht vorstellen.
Mein erster öffentlicher Auftritt in New York, im Herbst 1989, als die Explosion des Ostens alle Welt beschäftigte, fand bei einer Diskussion statt, die der amerikanische P.E.N. der rumänischen Literatur widmete und die »Das Wort als Waffe« überschrieben war. Den kämpferischen, der Tagesaktualität geschuldeten Ton mißachtend, sprach ich vom »Wort als Wunder«. Und ich beschrieb selbstverständlich auch den Julinachmittag 1945, an dem ich die fabelhaften volkstümlichen Geschichten des rumänischen Schriftstellers Ion Creangă entdeckt hatte.
Einige Tage darauf erhielt ich einen Brief von einer vornehmen Dame, einer Schriftstellerin und Übersetzerin rumänischen Ursprungs, die bei der Veranstaltung zugegen war. Sie wies mich auf antisemitische Texte und Ausdrücke des Schriftstellers hin. Ich kannte sie, kannte auch ähnliche Stellen bei anderen großen rumänischen Schriftstellern. Die deutsche Sprache war nicht nur die von Goethe und Schiller, sondern auch die der SS; das Rumänische des Caragiale und Bacovia war auch die Sprache von Zelea Codreanu, dem Căpitan der Eisernen Garde, und, in meiner Biographie, die Sprache der Liebe und Freundschaft, die Sprache, in der – selbst nach ihrem Tod – meine Eltern und Großeltern zu mir sprachen.
Nicht nur einmal hatte ich die Vorwürfe an jüdische Schriftsteller gehört, sie schrieben in der »Sprache ihrer Mörder«, oder an afrikanische Schriftsteller, sie schrieben in der »Sprache der Kolonialmacht«. Ich fühlte mich nicht schuldig, denn ich hatte meine Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Die Sprache erschafft und deckt den vergifteten Fluch ebenso wie die wundersame Metamorphose, den Kontrast zwischen der Trägheit des Geistes und dem kreativen Gedankenblitz. Der Körper der Kunst enthält Eiterherde, um so rätselhafter und wohltuender erscheint uns das Wundersame, in das sie sich verwandeln. Baudelaires »Blumen des Bösen« verweisen wie die »Schimmelblüten« des rumänischen Dichters Tudor Arghezi schon im Titel auf diese unbegreifliche Transzendierung.
Das Wunder des Wortes, von dem ich 1989 in New York sprach, bezog sich auf meine Muttersprache, nicht auf die neue Sprache, in die ich eingewandert war. Die Wunder dieser Sprache waren dem späten Schiffbrüchigen unzugänglich.
[...]
SINN UND FORM 6/2010, S. 725-738