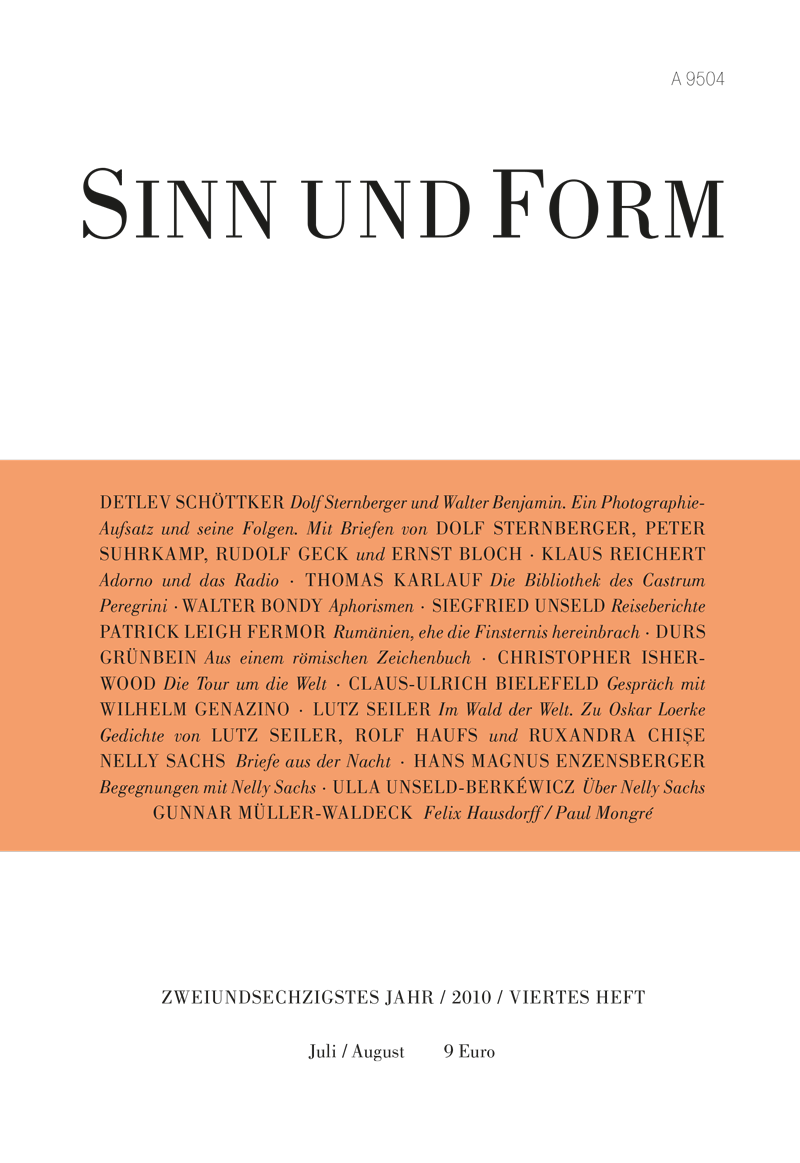Leseprobe aus Heft 4/2010
Fermor, Patrick Leigh
Rumänien - Reisen in einem Land, ehe die Finsternis hereinbrach
Unter dem Fenster der Nachtmaschine schimmerte Bukarest, schwach wie eine von Kerzen beleuchtete belagerte Stadt. Die Revolution, die die Welt in Staunen versetzt hatte, war gerade einen Monat alt, und als wir landeten, fragte ich mich, wie diese verblüffenden Ereignisse die Stadt verändert haben mochten; und, aus persönlichen Gründen, inwieweit sich das Land wohl von jenem unterschied, in dem ich vor dem Krieg ein paar Jahre gelebt hatte. Dazu müssen wir ein wenig zurückgehen. Genauer gesagt mehr als ein halbes Jahrhundert. Im Frühjahr 1934 war ich unterwegs auf meiner Wanderung nach Konstantinopel, auf der ich mit £ 1 pro Woche auskommen wollte und nächtigte, wo es sich gerade ergab; doch das alles änderte ein Empfehlungsschreiben kurz nach meinem neunzehnten Geburtstag in Ungarn – man lieh mir ein Pferd, auf dem ich die Pußta durchquerte, an die Stelle von Scheunen und Kuhställen traten Burgen und Landhäuser, und als ich schließlich die Grenze überquerte und nach Siebenbürgen kam – das Land aus der Sicht der Rumänen also durch die Hintertür betrat –, war aus dem harten Fußmarsch längst ein Ritt von Schloß zu Schloß geworden.
Die Leute, bei denen ich unterkam, waren weiterhin Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg war Siebenbürgen Rumänien zugesprochen worden, und der Verlust schien für die Ungarn beiderseits der Grenze ein Stich ins Herz zu sein. (Ich glaube, auf diesen Reisen habe ich alles aufgenommen außer Politik. Ich mochte die Ungarn, weil sie gastfreundlich, temperamentvoll und verwegen waren, und aus ähnlich persönlichen Gründen faßte ich später auch eine ebenso große Zuneigung zu den Rumänen.)
Die meisten Siebenbürger Ungarn – zwei Millionen – wohnten weit im Osten; meine neuen Freunde hingegen gehörten zu jenen verstreuten ungarischen Grundbesitzern, die seit Generationen in den westlichen, fast ganz von Rumänen bevölkerten Landesteilen lebten. Aber nach Herkunft und Religion verschieden von der übrigen Bevölkerung, zu sehr an ihre alten Häuser gebunden oder zu arm, um ihre Wurzeln auszureißen und in Ungarn von vorn zu beginnen, ähnelten sie den englischen Adelsfamilien in Irland, und in den Häusern fand ich den gleichen Hauch von Wehmut, den gleichen Charme. Sie führten ein verzaubertes Leben, das hundert Jahre hinter ihrer Zeit zurück war. Meine erste Station, nördlich von Arad, war das Anwesen von Baron Tibor Solymosy, einem fröhlichen Junggesellen und alten Kavalleristen. Das Haus stand, von Säulen getragen und palladisch, wie ein Abbild des Londoner Haymarket Theatre in einem Meer von Weinbergen. Der Aufenthalt wurde zu einer Art Initiation und endete, auf der Krone des weinlaubbekränzten Hügels, mit einem rauschenden Fest aller Nachbarn, bei dem wir zur Musik der Zigeunerkapelle bis zum Morgen tanzten. Danach wurde ich von Haus zu Haus weitergereicht wie ein Wanderpokal. Das nächste war eine Art Hazienda, umgeben von mächtigen Bäumen, und gehörte einem exzentrischen Polen und seiner ungarischen Frau Klara Zay, einer wilden, doch brillanten Reiterin. (Pferde spielten eine große Rolle. Die Straßen ruinierten die Autos, und so legte man kurze Strecken in klapprigen Landauern oder zu Pferde zurück.) Ötvenes, mein nächstes Ziel, war der Schauplatz von Schnitzeljagden im Wald und von Feuerwerk nach dem Abendessen. Die Fliederblüte ging schon zu Ende, doch es gab wilde Malven und rote und weiße Pfingstrosen, und auf den Schornsteinen saßen die flügge gewordenen Störche in ihren Nestern.
In Capalnas südlich des Flusses Mureș (Mieresch), im Haus des Grafen Jenö Teleki mit seiner berühmten Sammlung orientalischer Nachtfalter, vergingen die Tage wie im Fluge. Mein letzter und längster Aufenthalt war der bei Elemér v. Klobusicky – dem »István« früherer Berichte –, einem originellen und schneidigen ehemaligen Husaren, gerade alt genug, um den Weltkrieg noch mitgemacht zu haben; es waren Wochen voller merkwürdiger Abenteuer, die mit einer sommerlichen Spritztour durch Siebenbürgen endeten, in Begleitung eines ungestümen, unternehmungslustigen Mädchens, dem ich den Namen Angéla gegeben habe. In einem riesigen geborgten Wagen erkundeten wir drei die alten Städte Alba Iulia und Cluj (Weißenburg und Klausenburg) sowie die Magyarenmetropole Tîrgu Mureș (Neumarkt), Mittelpunkt des Landes der Szekler, die sich im 10. Jahrhundert dort angesiedelt hatten. Von da rasten wir weiter Richtung Süden nach Sighișoara (Segesvár oder Schäßburg), der schwindelerregenden Festung von Vlad dem Pfähler mit ihren Türmchen und Zinnen. Am nächsten Tag trennten wir uns, und ich war traurig und wieder allein.
Inzwischen war es August geworden. Ich stapfte südwärts entlang der Flanken des Retezatgebirges und blieb eine Weile im Lager rumänischer Schäfer hoch in den Bergen; zähe, ganz auf sich gestellte Menschen, die in einer Welt der steilen Wälder, der gewaltigen Herden, der Wölfe und Bären lebten. Danach stieß ich auf chassidische Juden, die weiter unten am Berg einen Holzeinschlag betrieben, überquerte die Donau und kam nach Bulgarien, schlief wieder in Scheunen und Gräben und erreichte am Neujahrstag des Jahres 1935 endlich Konstantinopel.
Doch noch vor Jahreswende war ich wieder in Rumänien, an einem Ort namens Baleni, wo ich lange blieb. Das Haus gehörte zwei rumänischen Schwestern, ein wenig älter als ich; wir hatten uns in Athen kennengelernt, wo die eine als Malerin lebte, und es entwickelte sich eine unbekümmerte Freundschaft. Ich wollte mit dem Schreiben beginnen, wir warfen unser Geld zusammen, und nachdem wir den Sommer und Herbst in einer Mühle auf der Peloponnes gemalt und geschrieben hatten, stellte sich die Frage: Wohin nun? Bald war die Antwort gefunden: »Wir haben da eine Bruchbude in der Moldau. Warum nicht dahin?« Nach einer Schiffsfahrt bis Constanza und der Weiterreise von Galatz nordwärts mit dem Zug stiegen wir an einem kleinen Bahnhof aus, wo ein alter polnischer Kutscher wartete; eine einstündige Fahrt brachte uns nach Baleni. Es war ein großes, weitläufiges, einstöckiges, weißes Herrenhaus, mit einem Dorf und Bäumen und einem Hof voller freundlicher Hunde. Ringsum erstreckten sich die winterlichen Täler der Moldau. Nach Osten hin, jenseits von Prut und Dnjestr, lag Rußland.
In jenen Tagen kam mir Rumänien vor wie ein fernes Land, und die Moldau, das nördliche der beiden alten Fürstentümer, die im 19. Jahrhundert zum späteren Königreich Rumänien vereinigt wurden, schien noch weiter weg zu sein. Das in der Walachei gelegene Bukarest war das blühende Zentrum des jungen Königreichs, und die bezaubernde Moldaukapitale Jassy, die Stadtresidenz der großen Bojaren des Nordens, versank in elegantem Niedergang. Historisch gesehen war die Moldau der bei weitem fremdere Landesteil. Das waldige Hügelland schwang sich nach Westen und Norden zu den Kieferwäldern der Karpaten auf – nach Ungarn, Siebenbürgen, der Slowakei, Polen und der Bukowina –, im Süden erstreckte sich die walachische Tiefebene, und nach Südosten folgte die von Vögeln bevölkerte Weite des Donaudeltas. Daran schloß sich das Schwarze Meer an; und im Osten ergoß sich die Steppe bis nach Bessarabien und in die Ukraine hinein. Die niedrig gelegenen Regionen waren im Sommer heiß und staubig und von Herden übersät, hier raschelten die Mais- und Kornfelder und die Luftspiegelungen flimmerten; im Winter verschwand alles unter einer dicken Schneedecke, und aus der Ferne hörte man das Heulen der Wölfe. Hie und da, lange Kutsch- oder Schlittenfahrten voneinander entfernt, beschattet von hohen Bäumen und Krähenhorsten, mit Kutschhäusern, Ställen, Schmieden, Scheunen und Katen dahinter, lagen die langgestreckten, ihren Gegenstücken in Turgenjews Romanen so ähnlichen moldauischen Gutshäuser, wie eine verstreute Flotte weißer Schiffe.
[…]
Aus dem Englischen von Manfred Allié
SINN UND FORM 4/2010, S. 486-495