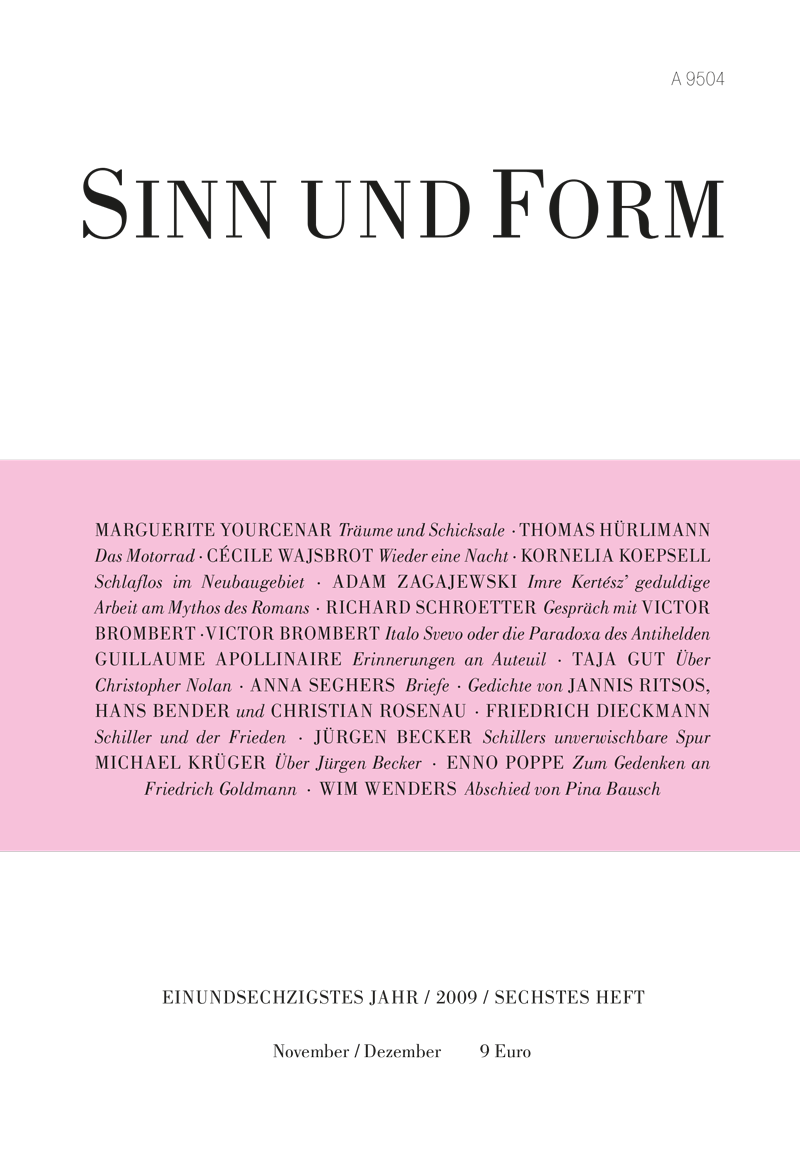Leseprobe aus Heft 6/2009
Zagajewski, Adam
Über die Treue. Imre Kertész’ geduldige Arbeit am Mythos des Romans
Im Prado hängt ein Bild von Francisco de Zurbarán, das Christus am Kreuz zeigt; zu seinen Füßen stehen aber nicht die traditionellen Figuren der christlichen Ikonographie, sondern ein Maler mit Palette – gewiß ein Selbstporträt, wenngleich der Titel suggeriert, es handele sich um den Evangelisten Lukas. Das Gemälde erweitert das traditionelle Passionsmotiv um ein Bild des Künstlers, das unter anderem für die ästhetische Selbstreflexion steht. Zurbarán sagt uns auf diese Weise, daß die Relation zwischen dem Göttlichen, dem Schmerz und dessen Darstellung selbst für die größten Künstler ein Geheimnis bleibt – so kann man es wenigstens deuten, auch wenn der Maler sein Werk wohl eher, wie Kunsthistoriker meinen, als Lob der Malerei verstanden sehen wollte. Es ist zutiefst anrührend, wie Zurbarán aus der Konvention ausbricht, ohne sie zu brechen, wie er dem Bild, einer meisterhaften und geradezu klassischen Kreuzigung, gleichsam ein Fragezeichen einschreibt.
Bei diesem bemerkenswerten Gemälde an Imre Kertész zu denken mag sonderbar erscheinen. Doch auch in seinem Werk begegnen sich zwei große Themen: das wohl größte uns bekannte Leid und das geduldige Nachdenken über die Möglichkeit und den Sinn, es zu beschreiben. Für Kertész ist das keine Frage des Gedächtnisses; die Erinnerung an manche Tage – zumal den ersten Tag im Lager – verblaßt nie, wie der »Roman eines Schicksalslosen« beweist. Ihn bewegt vielmehr die Frage, wie sich der Bericht aus Auschwitz und Buchenwald und das Nachdenken darüber in die Literatur und das Leben unserer Zeit überführen lassen. Seine Romane, vor allem der »Roman eines Schicksalslosen«, erzählen langsam und gewissenhaft, als richteten sie sich auch an künftige Generationen, die, der Spielereien der letzten Jahrzehnte überdrüssig, wieder einfachere Kost verlangen.
Kertész gehört zu den Autoren, die man durch ihre Essays besser, wenn nicht überhaupt erst versteht. Nicht, weil seine Romane schwierig wären und eines Kommentars bedürften, sondern weil sie im Gegenteil einfach zu sein scheinen und der an Nabokov und Borges geschulte Leser Komplizierungen und Spiegelungen sucht. In seinen Skizzen und Tagebüchern, etwa dem »Galeerentagebuch «, zeigt Kertész die gleiche Bescheidenheit und intellektuelle Redlichkeit wie in seinen Romanen. Das gilt auch für »Die exilierte Sprache«, eine Sammlung von Texten aus den Jahren 1990–2002: Reden bei Konferenzen, Tagebuchfragmente und Texte zu anderen Autoren, darunter ein vorzüglicher, höchst anregender Essay über den von ihm so bewunderten Sándor Márai.
»Die exilierte Sprache« beginnt mit »Budapest, Wien, Budapest«, einer ganz uneitlen Beschreibung seines ersten Wien-Besuchs. Kertész konstatiert die vielen kleinen Demütigungen, die den Osteuropäer erwarteten (und nicht selten noch heute erwarten), der es geschafft hatte, die magische, unseren kleinen Kontinent in zwei Hälften teilende Grenze zu überschreiten. Auch die folgenden Texte zeigen den Autor als stets bescheidenen Menschen. Kertész war zu seinem Glück und zum Glück für seine Weltsicht jahrelang kein Star; in der ungeschriebenen Hierarchie der ungarischen Literatur hatte er nur einen unbedeutenden Platz und war hauptsächlich als Übersetzer deutscher Literatur bekannt. So erzählt er – zur Freude des Lesers, denn bei einem inzwischen berühmten Autor liest sich das wie eine Fabel über den Lohn der Tugend, und das gefällt uns immer –, wie er in Budapest für einen westdeutschen Dramatiker dolmetschte und nicht aus seiner streng definierten Rolle fallen durfte (»Sie sollen nicht gratulieren, Sie sollen übersetzen.«).
Der Autor umkreist sein Hauptthema; mit der Zeit begreift er, daß sein Schicksal (ein verlorenes, wie es im polnischen Titel des »Romans eines Schicksalslosen « genannt wird), so lokal oder provinziell es in gewissem Sinne sein mag, der Reflexion und dem Schreiben eine Fülle von Stoff bietet, wenn man es in die mitteleuropäische Geschichte einbettet – eine Jugend in Auschwitz und Buchenwald, die Befreiung durch die US-Armee, Rettung, Heimkehr, kurze Begeisterung für den Kommunismus, arbeitsreiche graue Jahre in der Volksrepublik, dann das Ende des sowjetischen Sozialismus und die Leere der neuen Wirklichkeit. Auf originelle Weise bleibt er diesem verlorenen, nach und nach wiedergewonnenen Schicksal treu, er legt es frei wie ein Archäologe, der, sich selbst erforschend, am Fundament des eigenen Hauses gräbt.
Doch Kertész, der gerne Zitate einstreut, beruft sich auch auf Camus: »Und dabei habe ich noch nicht von der absurdesten Gestalt gesprochen: dem schöpferischen Menschen.« Obgleich er sich nicht allzu konkret für die Philosophie des Absurden interessiert, ist er nicht frei von Zweifeln, sein Tun scheint ihm zuweilen sogar absurd. Er zweifelt oft, doch es sind beinahe erlösende Zweifel, durch die er, auch wenn sie ihm das Schreiben noch schwerer machen und seinen Verleger schier zur Verzweiflung treiben, seine Aufgabe besser versteht. Kertész bleibt seinem Leben treu, dem Leben eines Juden, der »einst von den rechtmäßigen Behörden seines Landes – Ungarn – im Rahmen zwischenstaatlicher Vereinbarungen als versiegelte Warenlieferung an eine fremde Großmacht übersandt wurde zu dem ausdrücklichen Zweck seiner Ermordung«. Er bleibt seinem Leben treu, ohne dessen Gefangener zu werden. Er schreibt Essays, in denen er verwundert sein Schicksal, sein Schreiben und seine Obsessionen betrachtet und hinterfragt.
Indem er sich in Frage stellt, reagiert er auf einen Vorwurf, den er womöglich gar nicht kennt, was aber unwichtig ist, weil er nicht ihm, sondern allen Autoren gemacht wurde, die am eigenen Leibe erfahrenes historisches Unrecht literarisch verarbeiten. Der große W. B. Yeats hatte im »Oxford Book of Modern Verse«, einer Anthologie englischsprachiger Lyrik, die War Poets, darunter Wilfred Owen, einen der wichtigsten literarischen Zeugen des Ersten Weltkriegs, ausgelassen und wurde deshalb kritisiert. In seiner Erwiderung gebrauchte Yeats den von Matthew Arnolds geprägten Begriff des passive suffering. An Dorothy Wellesley schrieb er, Owens Gedichte verzeichneten, wie ein Seismograph, lediglich die Reaktion auf ein welthistorisches Ereignis und nicht den Kampf eines freien Menschen mit der Welt, einen Kampf, in dem auch der Mensch schuldig werden könne und in dem sich die Waagschalen bis zum Schluß höben und senkten.
Nach Yeats’ strengem Maßstab müßte man wohl nahezu die ganze Literatur Mitteleuropas als lächerlich eindimensional abtun, als vielstimmige Klage in der Art eines gigantischen und lachhaften passive suffering-Oratoriums. Es fragt sich aber, ob die Auffassung des großen Iren heute noch gelten kann. Müßte man ihm nicht vielmehr einen verspäteten Brief schreiben, der so beginnen könnte:
»Lieber William Butler Yeats,
noch immer bewegt uns Ihr Vorwurf gegen den armen Wilfred Owen. Die Debatte ist inzwischen – verspätet wie alle literarischen Erscheinungen – in dem Teil Europas angekommen, den manche als Ost-, manche als Mitteleuropa bezeichnen. Wir kennen Ihre Meinung und wissen, Sie mögen keine Lyrik – heute würden Sie wohl von Literatur insgesamt sprechen –, die auf individuell erlittenes historisches Unrecht reagiert, keine Dichter, die in ihrer unschuldigen Seele die Schläge der brutalen Welt registrieren. Sie glaubten vermutlich nicht an die Unschuld der Dichterseele, sondern hielten den Menschen für frei und meinten, er müsse immer auch nach der eigenen Schuld fragen. Die Auseinandersetzung mit anderen, so sagten Sie, erzeuge Rhetorik, Lyrik entstehe in der Auseinandersetzung mit sich selbst.
Doch betrachten Sie die europäische Geschichte. Nach Ihrem Tod im Januar 1939 breitete sich das Böse, das auch Sie kannten und über das Sie in schönen Gedichten meditierten, weiter aus. Es blühte schon zu Ihren Lebzeiten; Sie konnten nicht alles wissen, haben vielleicht nicht jeden Tag Zeitung gelesen; manches haben Sie auch bagatellisiert … Nun aber erlangte das Böse, das Sie nicht als Inspiration für Gedichte, Romane oder Dramen akzeptierten, eine solche Macht, daß die Befolgung Ihres Postulats, die Dichtung müsse passives Leiden vermeiden, den Tod der Imagination und das Aussterben der schönen Literatur bedeutet hätte. Die Anthologien wären leer geblieben, die Regale in den Buchläden verödet…
Manche Autoren sind buchstäblich durch die Hölle gegangen, obwohl sie – es wird Ihnen schwerfallen, das zu glauben – unschuldig waren. Was hätten die wenigen, die überlebten, denn tun sollen? Sie mußten beschreiben, was sie erlebt hatten, ohne die Schuld an ihrem Leid bei sich zu suchen. Das wäre einer Lüge gleichgekommen. Sie konnten nicht Ihnen zuliebe diese Zeit aus dem Gedächtnis streichen und auf ein aktiveres Leiden warten. Sie waren zu passivem Leiden verurteilt …
Und sollten nicht gerade wir Christen – gewiß, Ihre Religiosität war fern jeder Dogmatik – Verständnis für das passive suffering haben? Was war Christi Tod am Kreuz denn anderes …«
So könnte der Anfang eines Briefs an W. B.Yeats aussehen, in dem noch manches zu sagen wäre. Unterzeichner wären »einige mitteleuropäische Schriftsteller «, keine Verbandsfunktionäre, sondern ausschließlich Privatpersonen, darunter fiktive. Kertész könnte dazu gehören. In seinen Werken spricht ein Mensch, der das Schlimmste durchgemacht hat, aber auch – als wäre ein Schriftsteller kein Mensch – ein humorvoller, gelassener Autor, der seine Privilegien und Grenzen kennt. Dieser Autor erinnert an den Maler auf Zurbaráns Gemälde, er steht oft unter dem Kreuz, mit mitfühlendem, unsicherem Blick und einer Palette, auf der ein großes Fragezeichen leuchtet. Nur ist die Palette des Schriftstellers komplexer und zumeist unsichtbar – sie wäre schwer zu malen. Sie enthält viele Farben und Wesenszüge, die bei jedem Romancier oder Dichter anders sind. Kertész ist undogmatisch; zum Mißfallen vieler, die über die Erinnerung an die Shoah wachen, malt er auch ein ungeschöntes Bild des kommunistischen Totalitarismus. Man müßte noch einmal an Yeats schreiben, denn indem Kertész seiner Themenliste die Tristesse und alltägliche Grausamkeit des Kommunismus hinzufügt, verlängert er sein Sündenregister um ein zweites passive suffering. Doch hätte er als aufmerksamer und ehrlicher Beobachter anders handeln können?
Kertész stellt sich diesem Problem mit Humor. Vor allem aber glaubt er an die Literatur. In »Liquidation« sagt die Hauptfigur: »Doch ich glaube an die Literatur. An nichts sonst, einzig und allein an die Literatur. Die Menschen leben wie die Würmer, aber sie schreiben wie die Götter. Einst war es ein bekanntes Geheimnis, heute ist es in Vergessenheit geraten: Die Welt besteht aus Scherben, die auseinanderfallen, sie ist ein dunkles, zusammenhangloses Chaos, allein vom Schreiben zusammengehalten. Daß du überhaupt eine Vorstellung von der Welt hast, daß du weißt, was alles in der Welt geschehen ist, ja, daß du überhaupt eine Welt hast: das alles hat das Schreiben für dich erschaffen und erschafft es ununterbrochen, es ist der unsichtbare Spinnenfaden, der unser aller Leben zusammenhält, der Logos.«
Kertész’ Glaube an die Literatur und an das, was die Griechen Logos nannten, ist wohl seine größte Stärke. Er bewahrt ihn davor, in die Zeugenrolle gedrängt zu werden. In der angelsächsischen Literaturkritik wird Autoren, die über ihre Totalitarismuserfahrungen schreiben, oft das Etikett witness angeheftet – gemäß der Logik des Gerichtsverfahrens, in dem die Zeugenaussage nur ein Baustein ist und das letzte Wort, die abschließende Analyse und Deutung dem Richter vorbehalten sind. Ein wahrer Dichter oder Romancier ist aber nie bloß Zeuge; wenn er an den Logos glaubt, ist er zugleich Ankläger, Verteidiger und Richter seiner Welt. Doch der Vergleich des Logos mit einem Spinnenfaden sagt noch mehr: Für Kertész bietet der Logos Struktur, Konstruktion und Rettung, er ist aber auch Bedrohung und Falle, etwas Klebriges und Gefährliches.
Kertész fasziniert als Autor, der seinen Zeugenbericht ständig ergänzt, als handele es sich – im künstlerischen, nicht im faktographischen Sinne – um etwas Unabschließbares, wie die Suche nach Wahrheit. Sein Hauptwerk, der »Roman eines Schicksalslosen«, ein erschütterndes und doch ganz einfaches Buch, wird von anderen Romanen und Essays umrahmt, die alle die große Frage nach der Würde und der Bedeutung des Wortes stellen. Kertész verwahrt sich gegen jede Abwertung der Literatur. Sein Werk ist voller Zweifel, ob man das Grauen überhaupt darstellen kann, doch anders als viele Literaturtheoretiker stellt er den Wert des Worts nicht in Frage. Gleichwohl – die Spinnenfaden- Metapher! – kennt er auch die Debatten über die Unzuverlässigkeit der Sprache.
Er arbeitet am Mythos des Romans, des großen läuternden Romans; »Fiasko« und »Liquidation« handeln weniger von Menschenschicksalen als vom Schicksal des Romans, das heißt von dem einen fundamentalen, notwendigen Roman, den er schreiben wollte und auch schrieb – und von dem er weiter träumte, an dem er weiter arbeitete, obwohl er schon veröffentlicht war. Kertész’ Denken kreist um die Verteidigung des Logos; aber er ist kein abstrakt analysierender Philosoph, er ringt mit sich, mit dem Material seines Lebens und seiner Erinnerung.
Wenn man die Möglichkeiten betrachtet, die Autoren in unserem Teil Europas haben, dann markieren Imre Kertész und Emil Cioran – diese Verbindung liegt näher als die zu Zurbarán – die beiden Pole. Der Aphoristiker und Essayist Cioran – ein hochintelligenter, sprachmächtiger Autor, dem wir uns mit Sympathie, Bewunderung und Neugier, manchmal aber auch kritisch und sogar widerwillig zuwenden – wollte vermittels des Schreibens, der (französischen) Sprache seinem Leben entfliehen oder zumindest Abstand zu ihm gewinnen. Kertész hingegen, weniger raffiniert und weniger an Paradoxen interessiert, entscheidet sich für die Treue; er bleibt seinem Leben treu, bleibt sich treu als ungarischer Jude und Mensch, der Buchenwald und den Kommunismus überlebt hat, der viel gelesen und nachgedacht hat und der es nie besonders eilig hatte. Er verfügt über kein spektakuläres Material, überrascht den Leser nicht mit neuen Schreibweisen, und »Kaddisch für ein ungeborenes Kind« steht vielleicht zu sehr unter dem stilistischen Einfluß von Thomas Bernhard. Kertész dramatisiert sein Schicksal nicht oder jedenfalls nur so weit, wie es die Literatur verlangt (auch Schweigen kann dramatisch sein). Seine Bücher zeugen von bewundernswerter Beharrlichkeit beim Suchen und Bearbeiten dessen, was ihm aufgegeben wurde. Wir spüren, daß wir es mit einem zutiefst aufrichtigen Autor zu tun haben, der sich vor allem für das interessiert, was ist. Und der das Nachdenken über den Wert des Wortes wie einen Schirm über sein Schreiben spannt.
Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann
SINN UND FORM 6/2009, S. 751-756