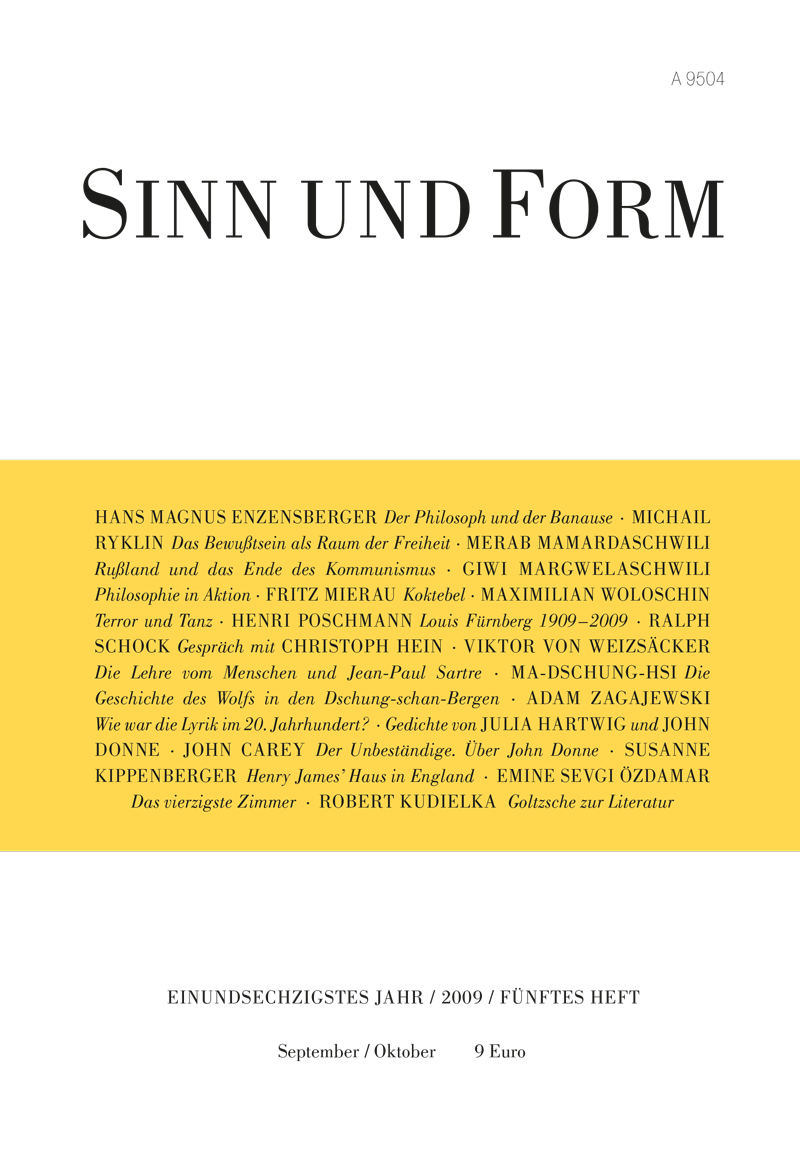Leseprobe aus Heft 5/2009
Hein, Christoph
Gespräch mit Ralph Schock
RAPLH SCHOCK: Vor mehr als 25 Jahren erschien Ihre Novelle »Der fremde Freund«. Sie fand große Resonanz. Wie denken Sie heute über diesen Text?
CHRISTOPH HEIN: Tatsächlich habe ich ihn schon 1981 geschrieben, vor 28 Jahren. Das Buch war für mich sehr wichtig, da es viel übersetzt wurde und immer wieder überraschende Reaktionen hervorrief. Beim Wiederlesen bekommt man mit, was man geschafft, was man nicht geschafft hat. Man schaut mit dem Interesse eines sehr viel älteren Kollegen auf die Arbeit dieses jungen Menschen.
SCHOCK: Sind Sie denn zufrieden mit der Arbeit des jungen Kollegen?
HEIN: Von ein paar Sachen bin ich sehr angetan und frage mich, ob ich dazu noch in der Lage wäre.
SCHOCK: Vielleicht war er in diesen Punkten weiter als der ältere Kollege?
HEIN: Er war auf jeden Fall unbeschwerter. Ich glaube, das hat mit der schönen Naivität zu tun, die man im Laufe des Lebens verliert. Ein Kind bewegt sich ja viel eleganter als ein zu Bewußtsein gekommener Erwachsener.
SCHOCK: Das sagt auch Kleist in seinem berühmten Aufsatz über das Marionettentheater. Fühlen Sie sich, um im Bild zu bleiben, denn heute eher als Marionette als früher?
HEIN: Nein, das nicht. Aber alles ist schwieriger geworden, weil man mehr Erfahrung hat. In anderen Berufen ist Erfahrung hilfreich, in meinem Beruf ist sie auch eine Erschwernis. Wenn man über jede Bewegung nachdenkt, die man in der Kindheit und Jugend mit Eleganz und Anmut einfach ausgeführt hat, wenn man sie also bewußt produziert, dann ist das eine Schwierigkeit.
SCHOCK: Kleist meinte, der gute Schauspieler müsse die Anstrengung vergessen machen, um die Anmut der Marionette wiederzuerlangen. Wenn er anfängt zu lernen und sich seines Tuns bewußt wird, verliert er seine ursprüngliche Naivität und muß sie sozusagen auf einer höheren Stufe zurückgewinnen.
HEIN: Kleist erinnert auch an die anmutige Skulptur des dornausziehenden Knaben. Er beschreibt, wie ein Freund eine ähnliche Haltung im Spiegel sah und vergeblich versuchte, sie nachzumachen.
SCHOCK: Der Knabe erleidet durch das Bewußtsein ein Lebenstrauma – wir nähern uns der Claudia Ihres Buches. »Der fremde Freund«, 1982 in der DDR erschienen, kam ein Jahr später in der Bundesrepublik unter dem Titel »Drachenblut« heraus. Die Änderung wurde nötig, weil gerade ein Buch von Klaus Harpprecht erschienen war, »Der fremde Freund: Amerika, eine innere Geschichte«. Welcher Titel gefällt Ihnen im nachhinein besser?
HEIN: Mein Titel ist nach wie vor »Der fremde Freund«. Ich glaube, er beschreibt auch die Novelle viel genauer. »Drachenblut« ist mir ein wenig zu düster, zu mythologisch belastet. Da denke ich eher an Fantasy-Literatur.
SCHOCK: Es ist natürlich eine Anspielung auf die Siegfriedsage, auf das Bad im Drachenblut und das berühmte Lindenblatt, das sich auf die Schulter des Helden legt – die verwundbare Stelle, an der Hagen von Tronje später mit der Lanze zustößt. Aber Sie haben nicht protestiert gegen diese mythologische Assoziation.
HEIN: Nein, ich fand die Titeländerung unnötig. Rein rechtlich war sie es auch, weil meine Novelle vor dem Harpprecht-Buch erschienen war. Ich wurde um einen neuen Titel gebeten, aber da ich keinen hatte, überließ ich es dem Luchterhand Verlag, einen zu finden. Diesen neuen Titel habe ich dann registriert und hingenommen. Bei den Übersetzungen haben sich einige Länder für diesen, andere für jenen Titel entschieden, also etwa »Dragonblood« oder »The Distant Lover«.
SCHOCK: Geschah das unabhängig von der Blockzugehörigkeit? Oder übernahmen beispielsweise die polnischen, russischen, rumänischen Übersetzungen den DDR-Titel?
HEIN: Das war den Verlagen freigestellt. Meist haben sie den genommen, der zu ihrer Sprache oder ihrer Kultur besser paßte.
SCHOCK: Sind denn beide Fassungen textidentisch?
HEIN: Da wurde nicht ein Komma verändert. So etwas habe ich nie akzeptiert. Texte sind für mich heilig, und zwar nicht nur die eigenen. Das hat vielleicht mit meiner Herkunft zu tun. Als Pfarrerssohn habe ich das so gelernt.
SCHOCK: Die Novelle beginnt, wenn man von dem Traum-Vorspiel absieht, auf das wir noch zu sprechen kommen, mit einer Beerdigung. Claudia, eine junge Ärztin, macht sich bereit, ihren Freund Henry Sommer zu Grabe zu tragen. Nach diesem ersten Kapitel kommen lange Rückblenden auf ihre Beziehung, auf die gescheiterte Ehe, auf Abtreibungen, auf ihre Kindheit. Dann wird die Beerdigung wieder aufgegriffen, im vorletzten Kapitel, und im letzten erfährt man, wie sich Claudia ein halbes Jahr später entwickelt hat und was mit ihr geschehen ist. Aus einer konkreten Erinnerungssituation wird so eine Art Lebensbilanz. Der Ort der Handlung ist unzweideutig die DDR: Man kann es aus Details erschließen, aus Wörtern, die Sie verwenden, aber auch aus historischen Anspielungen, etwa auf den 17. Juni. Die Zeit, 1981, ist ein bißchen schwieriger zu erschließen. Die Novelle spielte, als sie erschien, in der unmittelbaren Gegenwart. Claudia ist zu diesem Zeitpunkt vierzig, sie wurde also 1941 geboren. Das heißt, sie ist zwei, drei Jahre älter, als Sie damals waren. Auffallend ist, daß es keinen expliziten Erzählkommentar gibt. Sie schildern alles aus Claudias Perspektive. Was für eine Frau ist sie eigentlich?
HEIN: Eine Person, die ich schätze. Sie ist mir zwar fremd, aber ich kann ihre Haltung und Lebensumstände nachvollziehen. Sie hat eine gewisse Härte. Übrigens hat die Novelle einen durchgehenden Subtext: Wenn Claudia bestimmte Dinge sagt, merkt der Leser auch, was sie nicht sagt, nicht sagen will. Das ist eine Erfahrung, die wir oft sogar mit Freunden machen. Wir fragen, wie es ihnen geht, und die Antwort ist: Wunderbar! Doch an den Augen oder der Haltung oder am Ton erkennen wir, daß das nicht stimmt. Diese Art von Subtext wollte ich dem Buch einschreiben – für den Leser, der sich darauf einläßt. Wenn er es aber nicht will, muß das Ganze trotzdem funktionieren.
SCHOCK: Hat dieser Subtext mit Angst zu tun?
HEIN: Ja, und auch mit Verdrängung. Unsere Kommunikation wäre überfordert, wenn wir auf ein »Wie geht’s?« die Antwort bekämen: »Gut, daß du mich fragst! Setzen wir uns, ich muß dir erst mal eine Stunde lang alles erzählen.« Wir brauchen diese kleinen Verabredungen, damit wir eine Freundlichkeit sagen können, ohne daß uns der andere gleich mit seinem ganzen Leben konfrontiert.
SCHOCK: Welche weiteren Aspekte spielen bei dem Subtext noch eine Rolle?
HEIN: Claudia sagt, daß sie nicht darüber nachdenken will, mit wem sie zusammenlebt, und meint damit sich selbst. Sie hat Angst, das herauszubekommen, und fürchtet, daß sie dann ein Fall für die Psychiatrie würde. In dem Zusammenhang spricht sie auch von der besten aller möglichen Heilanstalten. Zu Voltaires Zeit gab es die Rede von der besten aller möglichen Welten. Geblieben und für uns erreichbar ist nur noch die beste aller möglichen Heilanstalten.
SCHOCK: Das Wort taucht noch an einer anderen Stelle auf. Als Claudia bei einem Ostseeurlaub die Touristen in ihrer Einheits-Wetterkleidung sieht, sagt sie: Die sehen aus wie aus einer Heilanstalt. Das ist wohl auf die DDR gemünzt?
HEIN: Nein, das ist auf beide deutsche Staaten gemünzt, denn dieser sogenannte Friesennerz, ein westliches Kleidungsstück, wurde damals im Westen wie im Osten gern getragen. Auf einmal sah man überall die gleiche orange, offenbar sehr praktische Strand- und Regenbekleidung.
SCHOCK: Trotzdem: Heilanstalt, Anstalt DDR, das ist schon eine naheliegende Assoziation. Dazu kommt, daß im Grunde alles, was Claudia erlebt, entweder trist oder banal oder pervers ist: das aggressive Verhalten gelangweilter Jugendlicher und noch manches andere. Was hat eigentlich die Zensur zu Ihrem DDR-Bild gesagt?
HEIN: Günther de Bruyn hat mich damals gefragt, wie ich es geschafft hätte, dieses Buch durch die Zensur zu bringen. Es war aber gar keine große Leistung meinerseits. Die hatten den Text wohl nicht so überaus mißtrauisch angeschaut. Ich war noch nicht so bekannt, und es war ein kleines Buch. Als es hieß, daß da was gestrichen werden sollte, tat ich so, als sei ich aufgeschlossen, denn ich wußte, daß sich darin eigentlich nichts streichen läßt. Es gibt keinen besonders schlimmen oder bösen Satz. Es war das Klima, der Ton der Novelle, der eine für die Zensur schwer erträgliche Stimmung beschrieb. Durch das Streichen eines einzelnen Satzes oder einer Seite ließ sich daran gar nichts ändern.
SCHOCK: Volker Braun zum Beispiel mußte 25 Jahre auf die Druckgenehmigung für ein Theaterstück warten. Man hätte auch Ihr ganzes Buch verbieten können, Gründe hätte man gefunden: Alkoholmißbrauch, Handwerker betrügen ihre Kunden, gesellschaftliche Gleichgültigkeit, Langeweile, schmutzige und verwahrloste Gegenden; ein Künstler propagiert die Anarchie und das Asoziale, lehnt also die gesellschaftliche Verantwortung des Künstlers explizit ab. In der DDR sei alles »wie im 19. Jahrhundert«. Die Lehrer sind sadistisch, die Portiers feindselig. Hinnert tritt aus Opportunismus in die Partei ein. Jedes dieser Details müßte doch eigentlich unerträglich sein für einen Zensor.
HEIN: So wie Sie das auflisten, läuft es mir auch jetzt noch kalt den Rücken runter. Offenbar hatte man eine solche Zusammenstellung nicht vorgenommen. Vielleicht lag es einfach daran, daß ich noch so jung und neu im Geschäft war, ich weiß es nicht genau. Ich hatte später bei anderen Sachen Schwierigkeiten mit der Zensur, bei Theaterstücken, wo ich auch zehn, zwölf Jahre warten mußte, und beim nächsten Roman. Nach dem aufsehenerregenden Erfolg des »Fremden Freundes« wurde er mit großem Mißtrauen betrachtet und bekam keine Druckgenehmigung. Daß er überhaupt erschien, war die Leistung des Verlegers, Elmar Faber, der ihn schließlich auf eigene Faust herausbrachte. Das ist meines Wissens das einzige Buch, jedenfalls das einzige belletristische, das ohne Druckgenehmigung, also gegen den Willen der Zensur erschienen ist.
SCHOCK: Wie ging das?
HEIN: Der Verleger erzählte mir, er habe anderthalb Jahre lang immer wieder um die Zustimmung der Zensurbehörde gebeten und sei immer abschlägig beschieden worden. Dann hatte er die Faxen dicke. Er rief in der Druckerei an und sagte, er habe die Druckgenehmigung. Dort sah man keinen Anlaß, das zu überprüfen. Und noch ehe das hohe Haus es mitbekam, nach zwei Tagen nämlich, war der Roman vergriffen. Daraufhin wurde der Verleger ins ZK ein- bestellt. Es ging um seinen Kopf, um die Frage, ob er das Haus weiter leiten dürfe. Meinen westdeutschen Verlag hatte ich gebeten, noch zu warten, weil es den Ostverlag in Schwierigkeiten gebracht hätte, wenn das Buch dort zuerst erschienen wäre. Luchterhand hat mitgemacht, obwohl es sicher schon aus ökonomischen Gründen schwierig war, ein bereits fertig gedrucktes Buch nicht auszuliefern.
SCHOCK: In einem Interview sagten Sie im Zusammenhang mit dem »Fremden Freund«, es müsse über den Stand unserer Zivilisation gesprochen werden, über die seelischen Kosten, die dieses durch die moderne Produktionsweise bestimmte Leben verursacht. Demnach wäre Claudia also der Prototyp eines Menschen, den die Verhältnisse in der DDR hervorgebracht haben. Das ist doch eigentlich auch Dynamit.
HEIN: Das ist allerdings eine nachträgliche Überlegung.
SCHOCK: Aber zu DDR-Zeiten?
HEIN: Ich kann nicht mit einer theoretischen, abstrakten Haltung an einen Text herangehen. Ausschlaggebend für diese Arbeit war der Tod eines Bekannten. Ich hatte die Geschichte zunächst aus der Sicht eines Mannes erzählt. Nach einem halben Jahr langweilte mich das. Die Hälfte des Romans war fertig. Ich habe alles weggeworfen und mich entschlossen, ihn aus der Sicht der Frau zu erzählen. Das war natürlich ein Wagnis. Der Verlag sagte gleich: So etwas ging im 18. Jahrhundert, aber heute nicht mehr! Das wußte ich ja alles, aber ich wollte es einfach mal probieren. Als ich später gefragt wurde, warum dieses Buch in ganz verschiedenen Ländern so erfolgreich war, kam mir der Gedanke, daß ich darin wahrscheinlich die Kosten unserer Zivilisation beschreibe: Die Großfamilie ist zerschlagen. Unsere Produktion braucht sie nicht mehr. Sie braucht den ständig verfügbaren Single, der von niemandem behindert wird. Der Single ist das in unserer Zivilisation bevorzugte Individuum. Vielleicht war das einer der Gründe für den internationalen Erfolg der Novelle. […]
SINN UND FORM 5/2009, 628-639, hier S. 628-632
Befristetes Angebot:
Den gesamten Beitrag kostenlos als PDF herunterladen.