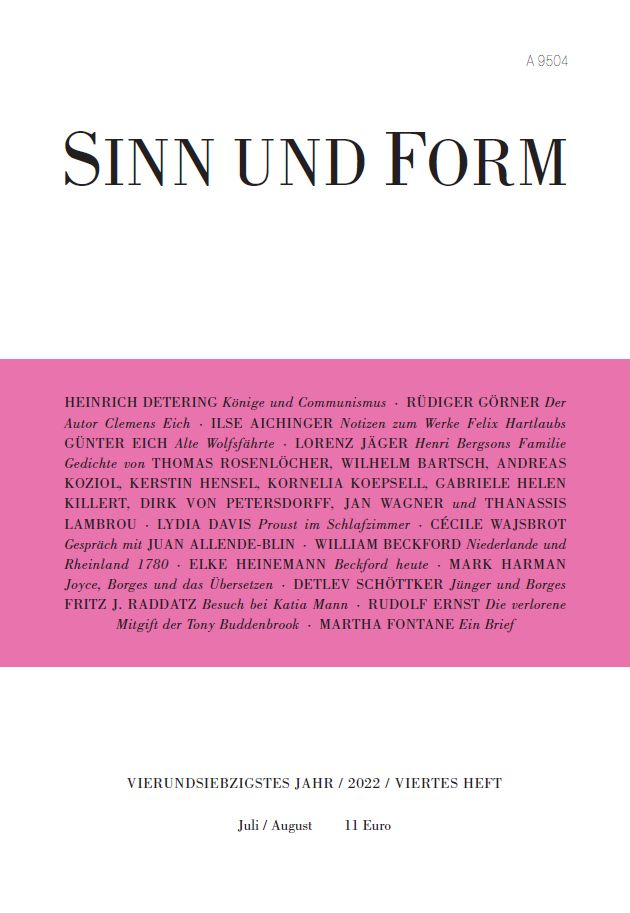
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-66-9
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Heft 4/2022 enthält:
Detering, Heinrich
Könige und Communismus. Eine Erinnerung an Bettine von Arnim 437, S. 437
Am offensichtlichsten ist der literarische Übergang von Romantik zu sozialkritischem Realismus im Werk Heinrich Heines, vom »Buch der Lieder« bis (...)
Rosenlöcher, Thomas
Mäandertal, S. 450
Görner, Rüdiger
»Ich beginne zu wollen, was ich bin« Zum Werk von Clemens Eich, S. 453
Aichinger, Ilse
Notizen zum Werke Felix Hartlaubs. Mit einer Vorbemerkung von Andreas Dittrich und Jannis Wagner, S. 463
Bartsch, Wilhelm
Die Zukunft geht am Stock. Gedichte, S. 470
Eich, Günter
Alte Wolfsfährte. Hörstück. Mit einer Nachbemerkung von Roland Berbig, S. 479
Koziol, Andreas
Vom Nebel verschlungen. Gedichte, S. 484
Jäger, Lorenz
Henri Bergsons Familie, S. 489
Killert, Gabriele Helen
Neue Xenien. Gedichte [Gabriele Helen Killert, Kornelia Koepsell, Kerstin Hensel, Dirk von Petersdorff], S. 497
Davis, Lydia
Proust im Schlafzimmer, S. 500
Wagner, Jan
Python. Gedichte, S. 512
Wajsbrot, Cécile
Ein Gespräch mit Juan Allende-Blin übers Komponieren, über Literatur und Exil, S. 516
Beckford, William
Reise durch die Vereinigten Provinzen und das Rheinland im Jahre 1780, S. 522
Heinemann, Elke
Versuch über William Beckford im Jahr 2022, S. 534
1
Social distancing, ein Schlagwort der Covid-19-Pandemie, läßt nicht von ungefähr an einen Mann denken, der 1760 in England geboren wurde (...)
Lambrou, Thanassis
Auf dem Hochseil. Gedichte, S. 540
Harman, Mark
Borges’scher als Borges? – Joyce, Borges und das Übersetzen, S. 542
Schöttker, Detlev
Ernst Jüngers Leser in Buenos Aires. Jorge Luis Borges und die erste Übersetzung der »Stahlgewitter«, S. 549
Raddatz, Fritz J.
Besuch bei Katia Mann und Gespräche mit Lou Eisler-Fischer, Charlott Frank und Walter Mehring. Mit einer Nachbemerkung von Joachim Kersten, S. 552
Ernst, Rudolf
Die verlorene Mitgift der Tony Buddenbrook, S. 559
Tony Buddenbrook mit ihrer charmanten Naivität und ihrem ausgeprägten Standesbewußtsein ist für viele Leser von Thomas Manns »Buddenbrooks« die (...)
Fontane, Martha
»Für Papa ist es sehr nöthig, daß er heraus kommt« Ein Brief an Anna Witte. Mit einer Nachbemerkung von Regina Dieterle, S. 562
