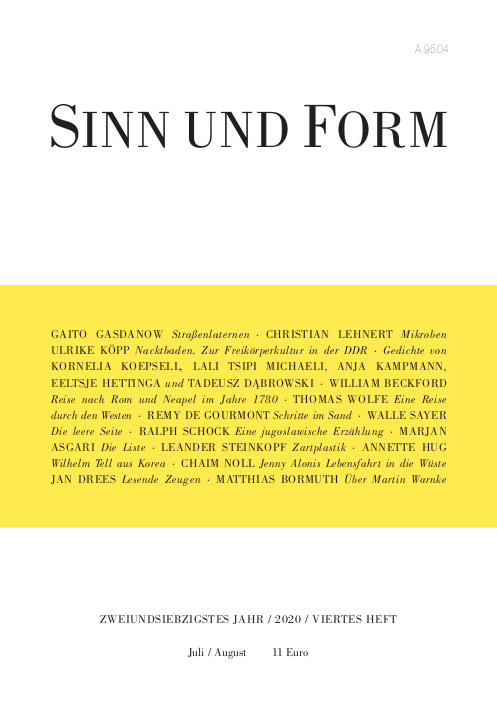
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-54-6
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Heft 4/2020 enthält:
Gasdanow, Gaito
Straßenlaternen, S. 437
Die Bibliothek Sainte-Geneviève in Paris hat meines Erachtens vor allem den Nachteil, daß Rauchen dort verboten ist; weil ich gezwungen war, lange (...)
Koepsell, Kornelia
Weiße Elegien. Gedichte, S. 451
Lehnert, Christian
Mikroben, S. 454
Michaeli, Lali Tsipi
Zeigst mir das Meer. Gedichte, S. 468
Köpp, Ulrike
Nacktbaden. Technik des Glücks. Zur Freikörperkultur in der DDR, S. 470
Wie angewurzelt stand ich in der Alten Nationalgalerie vor dem Gemälde, ich hatte die gelöste Szenerie der Nacktbadenden am Ostseestrand (...)
Kampmann, Anja
Seeigel. Gedichte, S. 484
Beckford, William
Reise nach Rom und Neapel im Jahre 1780, S. 488
Hettinga, Eeltsje
Ein Spiegel das Meer. Gedichte, S. 504
Wolfe, Thomas
Eine Reise durch den Westen. Mit einer Vorbemerkung von Kurt Darsow, S. 508
Zeitlose Zeit. Eine Vorbemerkung Die Legende vom »hungrigen Gulliver« ist schon oft erzählt worden. Daß Thomas Wolfe (1900–1938) sein (...)
Gourmont, Remy de
Schritte im Sand. Aphorismen, S. 532
Sayer, Walle
Die leere Seite im Reisetagebuch, S. 535
Dąbrowski, Tadeusz
Das Keimen neuer Wörter. Gedichte, S. 538
Schock, Ralph
Die Abkürzung. Eine jugoslawische Erzählung, S. 541
Asgari, Marjan
Die Liste, S. 549
Steinkopf, Leander
Zartplastik, S. 552
Hug, Annette
Wilhelm Tell aus Korea. Eine literarische Unterwanderung, S. 555
Noll, Chaim
»Ein großer verwirrender Irrtum«. Jenny Alonis Lebensfahrt in die Wüste, S. 560
Drees, Jan
Lesende Zeugen. Laudatio zum Kurt-Wolff-Preis 2020, S. 563
Bormuth, Matthias
Wort und Bild. Martin Warnke zum Gedächtnis, S. 568
