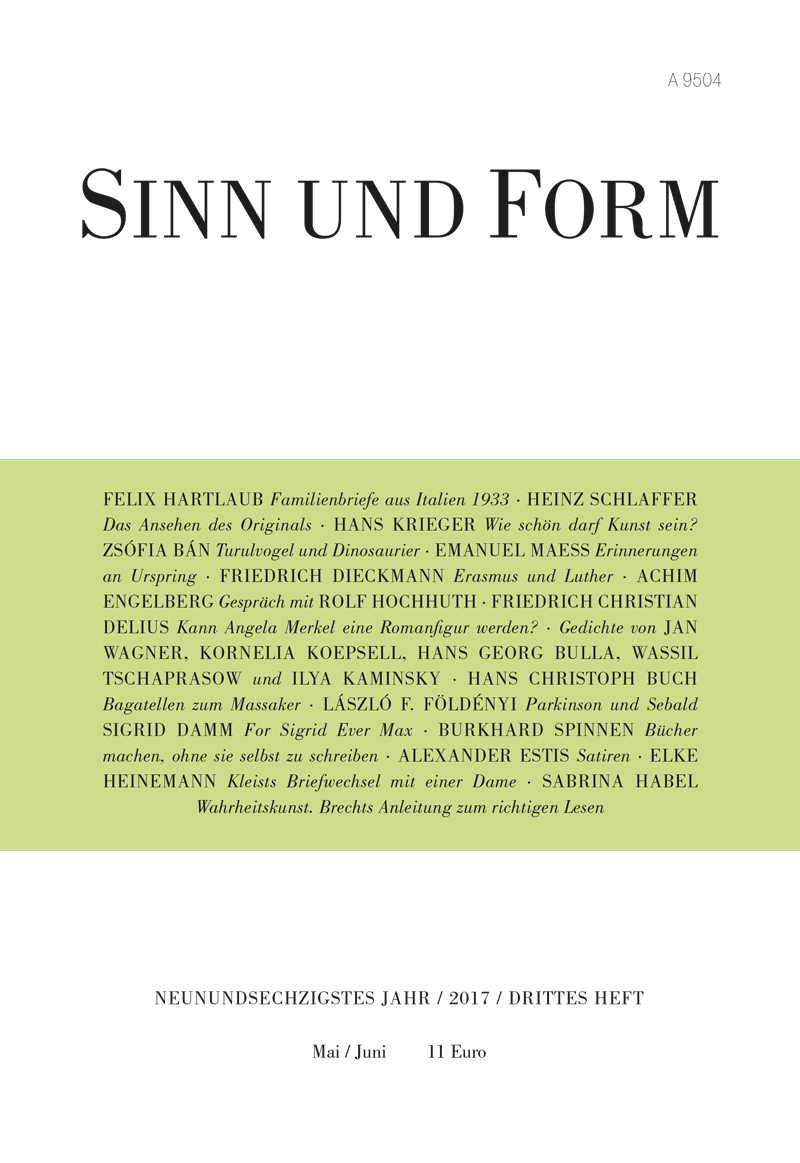Heft 3/2017 enthält:
Hartlaub, Felix
»In Neapel war ich sehr von der eigentlichen Ohnmacht der Kunst vor dem Leben überzeugt«. Briefe an die Familie aus Italien , S. 293
Vorbemerkung Italien: Sehnsuchtsland der Deutschen. Nicht nur Touristen zieht es gen Süden, auch Schriftsteller konnten und können sich der (...)
Koepsell, Kornelia
The Course of Empire. Gedichte, S. 318
Schlaffer, Heinz
Das Ansehen des Originals , S. 321
Krieger, Hans
Wie schön darf Kunst sein?, S. 329
Bán, Zsófia
Der Turulvogel und der Dinosaurier. Fabulamento, S. 336
Wagner, Jan
Kalifornische Sonette, S. 343
Maeß, Emanuel
Werra und Wehr. Erinnerungen an Urspring, S. 347
Engelberg, Achim
»Zum Streit reizet allzu langer Frieden«. Ein Gespräch über Krieg, Kunst und Mut. Mit Rolf Hochhuth, S. 356
Bulla, Hans Georg
Der Tag lief uns nach. Gedichte, S. 364
Dieckmann, Friedrich
Erasmus und Luther. Doppelbild einer Umbruchszeit , S. 367
Tschaprasow, Wassil
Alte Worte. Gedichte, S. 374
Delius, Friedrich Christian
Kann Angela Merkel eine Romanfigur werden?, S. 377
Einen Punkt hab’ ich noch: Kann Angela Merkel eine Romanfigur werden? fragte mich eine Studentin, und ich sagte ohne zu zögern: Nein. Aber Sie (...)
Buch, Hans Christoph
Bagatellen zum Massaker oder Der Schriftsteller ist zu größerer Verworfenheit fähig als andere Menschen, S. 387
Kaminsky, Ilya
Autorengebet. Gedichte, S. 398
Földényi, László F.
Ein Labyrinth ohne Ausweg. Melancholische Erinnerungen an Michael Parkinson und W. G. Sebald, S. 401
Damm, Sigrid
For Sigrid Ever Max, S. 411
Spinnen, Burkhard
Bücher machen, ohne sie selbst zu schreiben. Laudatio zur Verleihung der Kurt Wolff Preise, S. 413
Estis, Alexander
Von den modernen Kunststücken. Satiren, S. 418
Heinemann, Elke
Kleists Briefwechsel mit einer Dame oder Über die allmähliche Verfälschung der Schriften beim Redigieren, S. 420
Habel, Sabrina
Wahrheitskunst. Brechts Anleitung zum richtigen Lesen, S. 422
Für Bertolt Brecht ist Wahrheit nicht nur eine Frage der Gesinnung, sondern auch eine Frage des Könnens. Die Wahrheit, schreibt er, wird (...)