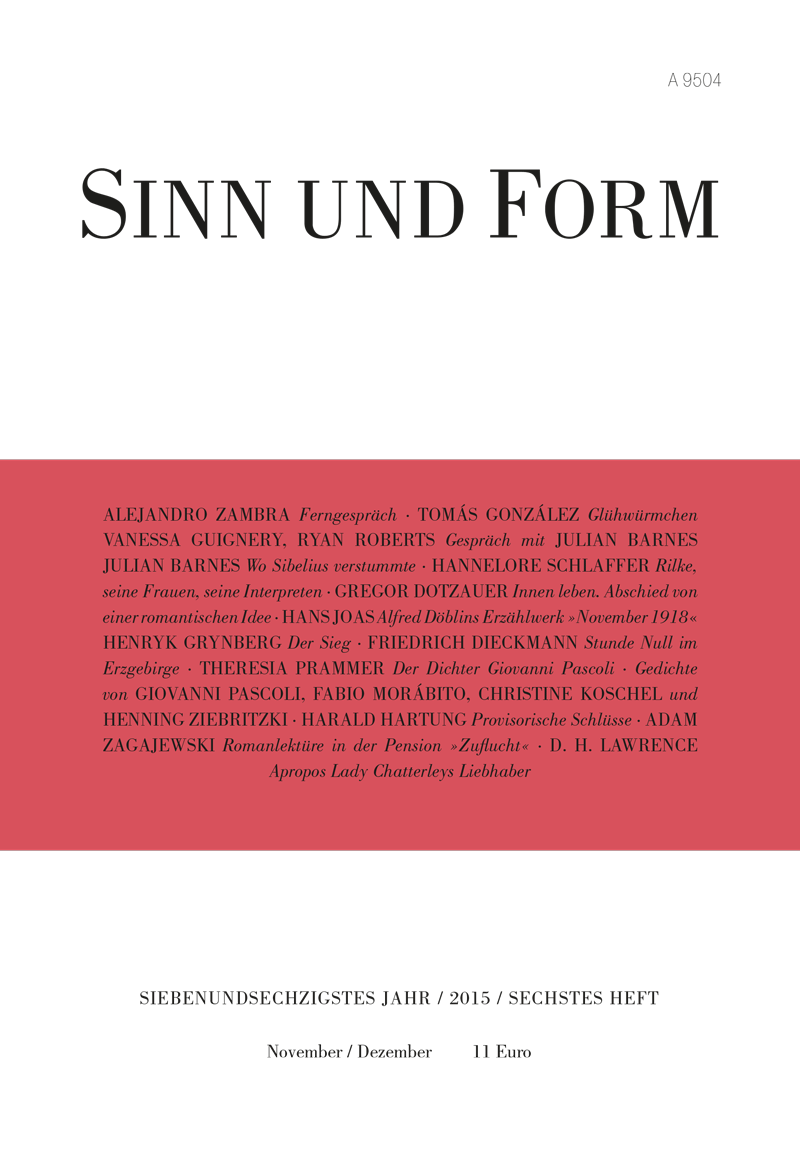Heft 6/2015 enthält:
Zambra, Alejandro
Ferngespräch, S. 725
Morábito, Fabio
Schalte die Finsternis an. Gedichte, S. 736
González, Tomás
Glühwürmchen, S. 741
Guignery, Vanessa; Roberts, Ryan
»Was der Tod alles mit sich bringt.« Gespräch mit Julian Barnes, S. 745
Barnes, Julian
Wo Sibelius verstummte, S. 759
Koschel, Christine
Auf der Insel Aberland. Gedichte, S. 764
Schlaffer, Hannelore
Zweierlei Sprache.
Rilke, seine Frauen, seine Interpreten, S. 766
Dotzauer, Gregor
Innen leben. Abschied von einer
romantischen Idee, S. 774
1 In Peking hängen die Wolken an versmogten Tagen so tief, daß einem der Himmel bis in den Hauseingang nachkriecht. Das Firmament hockt auf der (...)
Joas, Hans
Ein Christ durch Krieg und Revolution.
Alfred Döblins Erzählwerk »November 1918«, S. 784
Wie der Selbstmord erscheint uns die religiöse Konversion als individueller Akt im reinsten Sinne. Wir nehmen an, daß erschütternde existentielle (...)
Grynberg, Henryk
Der Sieg. Mit einer Nachbemerkung
von Lothar Quinkenstein, S. 800
Dieckmann, Friedrich
Stunde Null im Erzgebirge.
Eine Kindheitserinnerung, S. 811
Ziebritzki, Henning
Vogelwerk. Gedichte, S. 827
Prammer, Theresia
Mönchsgrasmücken, Tamarisken,
Bekassinen. Der Dichter Giovanni Pascoli, S. 830
oci oci oci oci oci oci, fi fideli fideli fideli fi, ci cieriri ci ci cieriri, ci ri ciwigk cidiwigk fici fici. Oswald von (...)
Pascoli, Giovanni
Drachensteigen. Gedichte, S. 835
Hartung, Harald
Provisorische Schlüsse, S. 841
Zagajewski, Adam
Romanlektüre in der Pension »Zuflucht«.
Dankrede zum Heinrich-Mann-Preis, S. 851
Lawrence, D.H.
Apropos Lady Chatterleys Liebhaber, S. 855