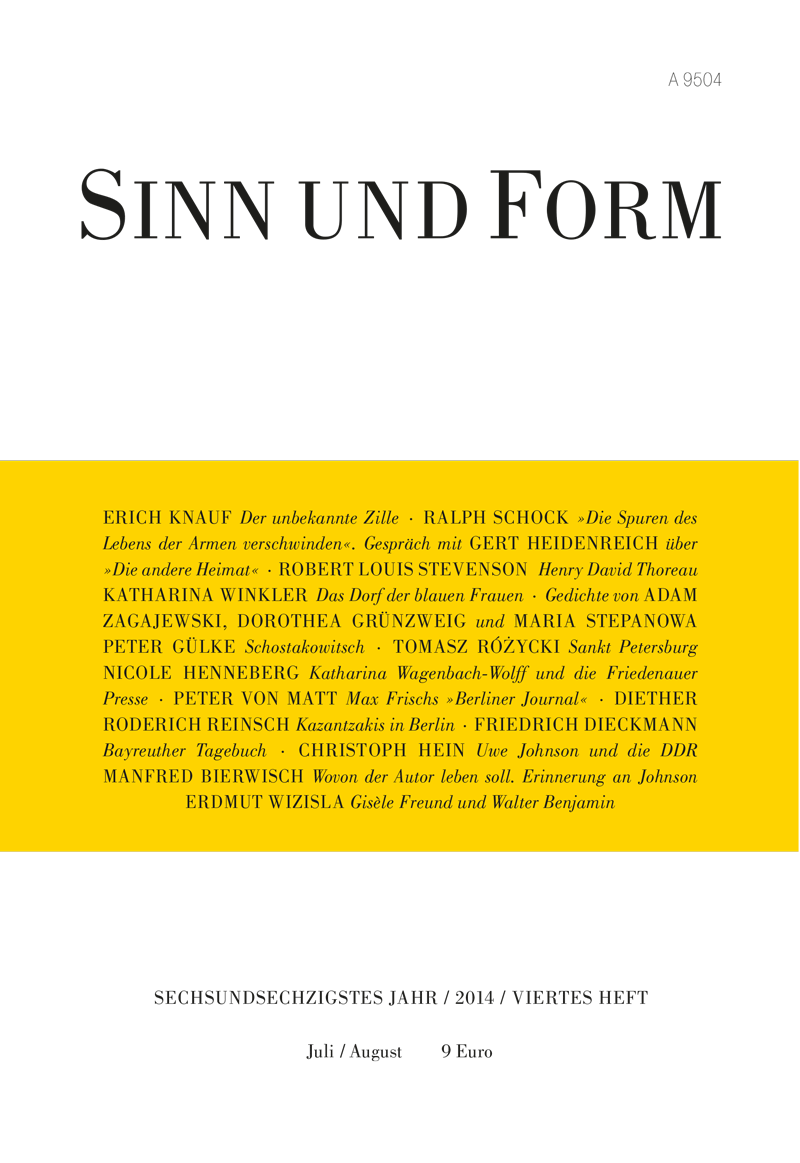Heft 4/2014 enthält:
Knauf, Erich
Der unbekannte Zille. Mit einer Nachbemerkung von Wolfang Eckert, S. 437
In der ersten Schwarz-Weiß-Ausstellung der Berliner Sezession 1901 war Zille mit einigen seiner besten Arbeiten vertreten. Er war damals noch im (...)
Zagajewski, Adam
Geh durch diese Stadt in einer grauen Stunde. Gedichte, S. 464
Schock, Ralph
»Die Spuren des Lebens der Armen
verschwinden«. Ein Gespräch mit Gert Heidenreich
über »Die andere Heimat«, S. 470
RALPH SCHOCK: Ihre Erzählung »Die andere Heimat« hat eine Menge mit dem gleichnamigen Film von Edgar Reitz und Ihnen zu tun, denn Sie sind (...)
Stevenson, Robert Louis
Henry David Thoreau.
Sein Charakter und seine Überzeugungen, S. 480
I Thoreaus schmales eindringliches Gesicht mit der großen Nase deutet selbst in einem schlechten Holzschnitt noch auf seine geistigen und (...)
Grünzweig, Dorothea
Schwimmen am Steg. Gedichte, S. 501
Winkler, Katharina
Das Dorf der blauen Frauen, S. 504
Stepanowa, Maria
Gesang unter Wasser. Gedichte, S. 518
Gülke, Peter
Schostakowitsch, S. 520
Różycki, Tomasz
Sankt Petersburg, S. 526
Henneberg, Nicole
Sankt Petersburg und Berlin.
Katharina Wagenbach-Wolff und die Friedenauer Presse, S. 532
Literarische Leidenschaften und spektakuläre Entdeckungen prägen das Leben von Katharina Wagenbach-Wolff, in deren Biographie sich das zwanzigste (...)
Matt, Peter von
Schreiben als Akt der Forschung.
Max Frischs »Berliner Journal«, S. 542
Reinsch, Diether Roderich
Kazantzakis in Berlin, S. 547
Dieckmann, Friedrich
Ring frei! Bayreuther Tagebuch, S. 553
Hein, Christoph
Nicht mit dir und nicht ohne dich.
Uwe Johnson und die DDR, S. 558
Bierwisch, Manfred
Wovon der Autor leben soll.
Erinnerung an Uwe Johnson, S. 563
Wizisla, Erdmut
»Also noch etwas Geduld und Mut«.
Anmerkungen zu Gisèle Freund und Walter Benjamin, S. 565