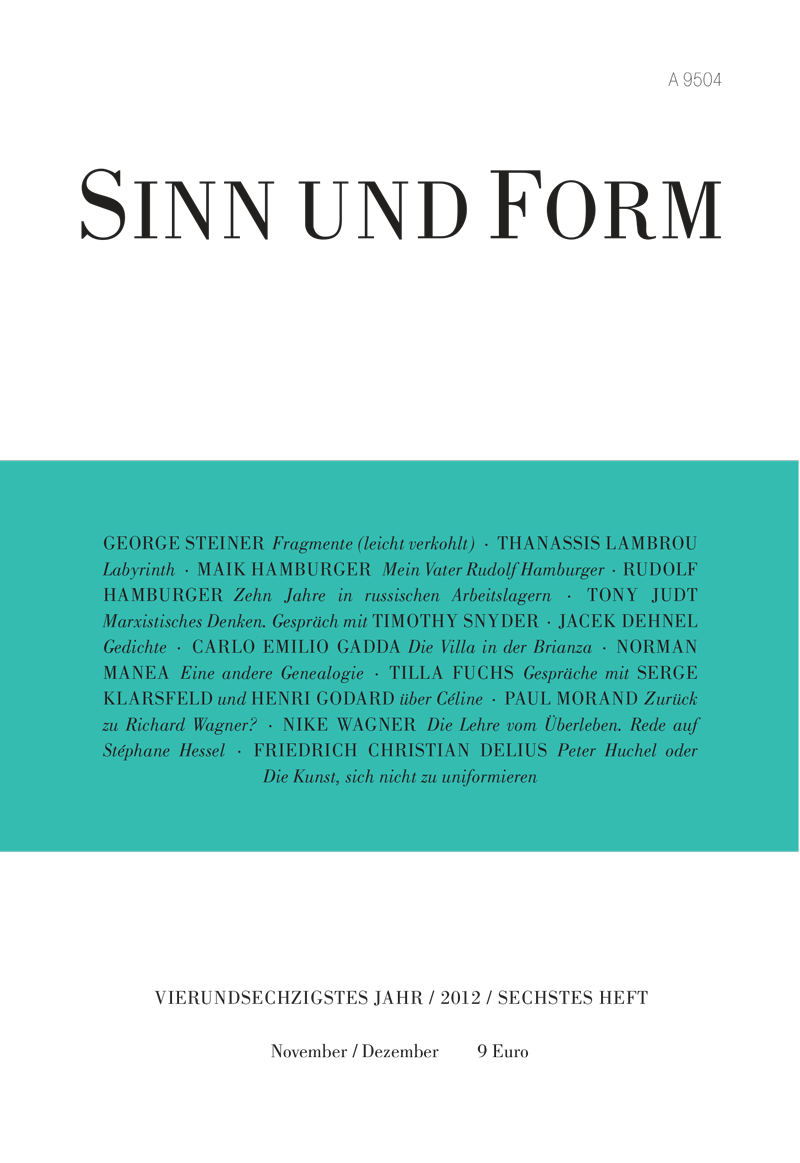Heft 6/2012 enthält:
Steiner, George
Fragmente (leicht verkohlt), S. 725
Diese aphoristischen Fragmente kamen auf einer der verkohlten Schriftrollen zum Vorschein, die unlängst in einer vermutlich als (...)
Lambrou, Thanassis
Labyrinth, S. 753
Hamburger, Maik
Mein Vater Rudolf Hamburger oder Die Abgründe des kurzen 20. Jahrhunderts, S. 758
In frühester Erinnerung steht er vor mir, sportlich gekleidet in Jacke und Knickerbocker aus englischem Tweed. Der ruhige braune Ton des (...)
Hamburger, Rudolf
Zehn Jahre Lager. Bericht über die Inhaftierung in russischen Arbeitslagern 1943-1952, S. 769
Judt, Tony
Marxistisches Denken. Gespräch mit Timothy Snyder, S. 791
Dehnel, Jacek
Gedichte, S. 806
Gadda, Carlo Emilio
Die Villa in der Brianza, S. 810
Manea, Norman
Eine andere Genealogie, S. 819
Fuchs, Tilla
Gespräche mit Serge Klarsfeld und Henri Godard über Céline, S. 825
Morand, Paul
Zurück zu Richard Wagner?, S. 842
Wagner, Nike
Die Lehre vom Überleben. Rede auf Stéphane Hessel, S. 849
»Il n’y a que du bon à dire de lui«, es gibt nur Gutes über ihn zu sagen, meinte neulich unser französischer Botschafter Monsieur (...)
Delius, Friedrich Christian
Peter Huchel oder Die Kunst, sich nicht zu uniformieren, S. 855