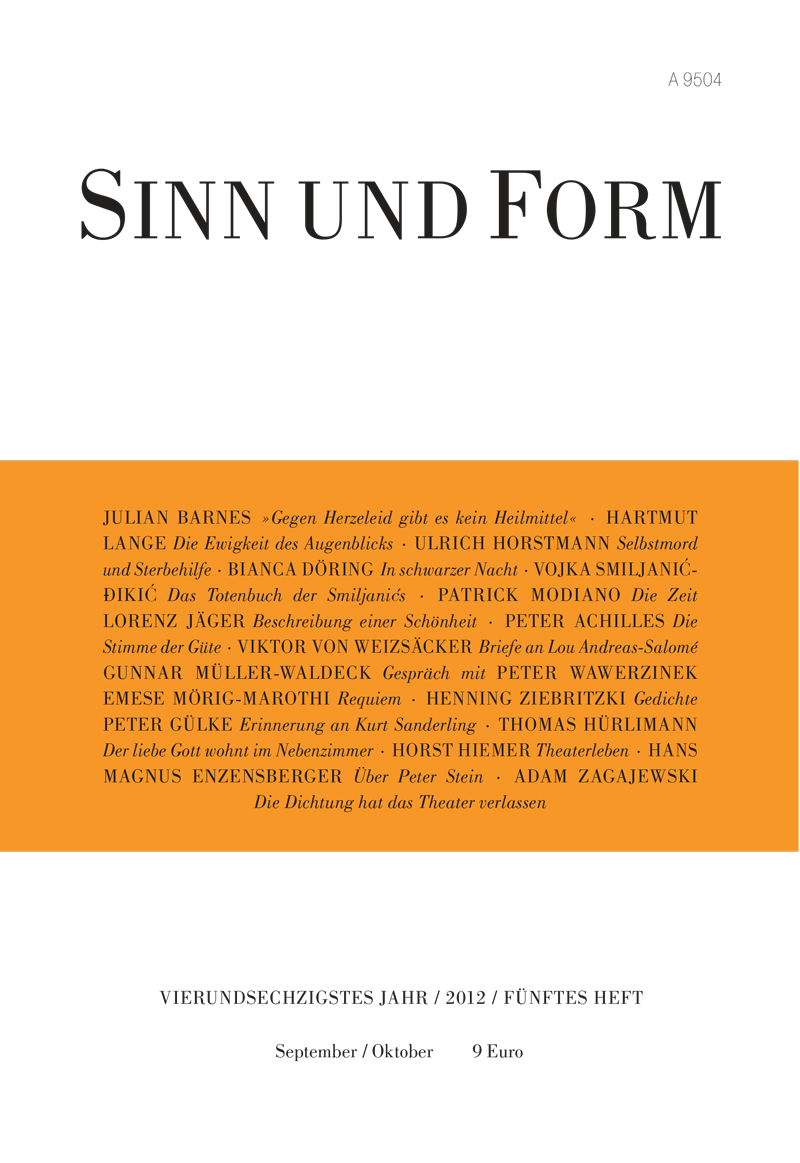Heft 5/2012 enthält:
Barnes, Julian
»Gegen Herzeleid gibt es kein Heilmittel.« Joan Didion, Joyce Carol Oates und das Trauern, S. 581
Lange, Hartmut
Die Ewigkeit des Augenblicks, S. 591
Horstmann, Ulrich
Wider das Herumdoktern an den Notausgängen. Selbstmord und Sterbehilfe. Eine Polemik, S. 605
Nach knapp zwei Jahrtausenden scheinen wir angesichts der offenbar unausrottbaren menschlichen Neigung, die biologische Aufenthaltserlaubnis (...)
Döring, Bianca
In schwarzer Nacht. Gedichte, S. 614
Smiljanic-Dikic, Vojka
Das Totenbuch der Smiljanics aus Sarajevo, S. 616
Modiano, Patrick
Die Zeit, S. 620
Jäger, Lorenz
Beschreibung einer Schönheit, S. 630
Achilles, Peter
Die Stimme der Güte. Zu Viktor von Weizsäckers Briefen an Lou Andreas-Salomé, S. 638
I.
1931 erschien Lou Andreas-Salomés »Mein Dank an Freud. Offener Brief an Professor Sigmund Freud zu seinem 75. Geburtstag«. Diese Schrift (...)
Weizsäcker, Viktor von
Briefe an Lou Andreas-Salomé, S. 649
Müller-Waldeck, Gunnar
»Die Fata Morgana ist unser Wanderstab«. Gespräch mit Peter Wawerzinek, S. 660
Möhrig-Marothi, Emese
Requiem, S. 672
Ziebritzki, Henning
Gedichte, S. 676
Gülke, Peter
Erinnerung an Kurt Sanderling, S. 680
Hürlimann, Thomas
Der liebe Gott wohnt im Nebenzimmer, S. 692
Hiemer, Horst
Theaterleben. Geschichten und Erfahrungen, S. 694
Aus dem Deutschen Theater
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs versachlichte sich die Theaterarbeit. Auch die Bühnenbilder änderten (...)
Enzensberger, Hans Magnus
Kurzgefaßter Versuch, Peter Stein zu rühmen, S. 711
Zagajewski, Adam
Die Dichtung hat das Theater verlassen, S. 712