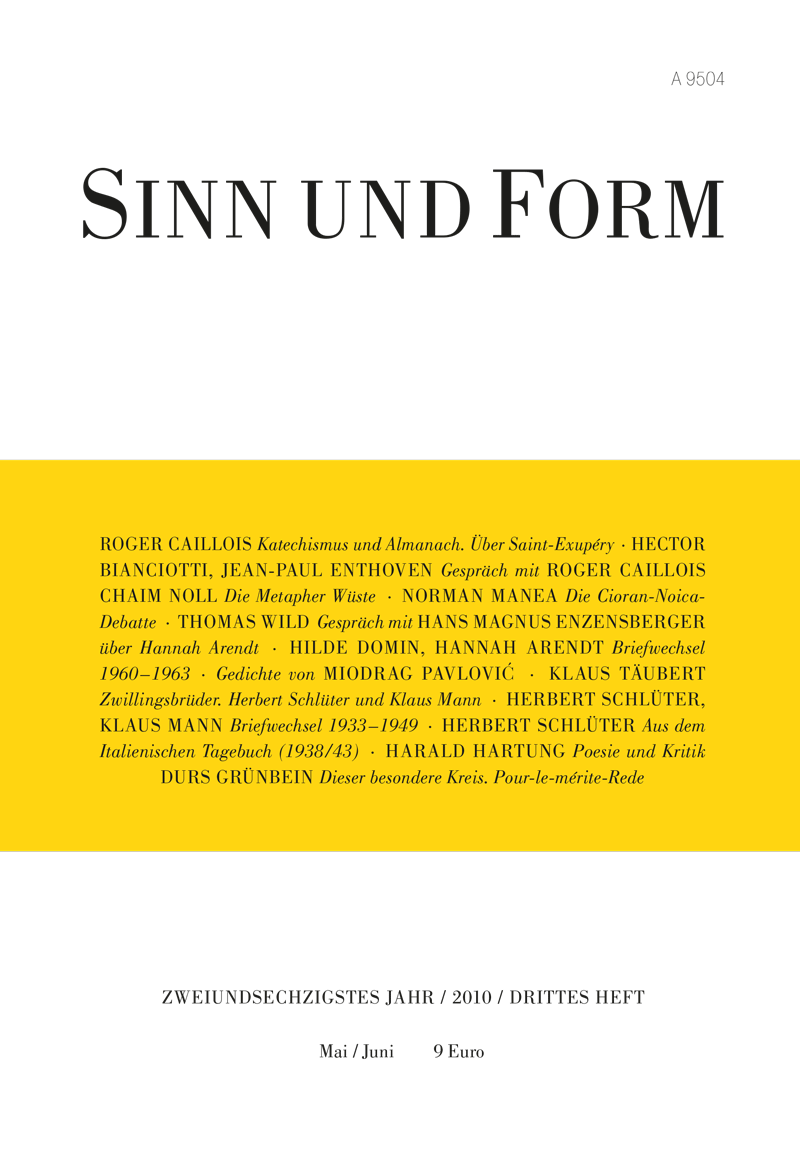Heft 3/2010 enthält:
Caillois, Roger
Katechismus und Almanach. Über Saint-Exupéry, S. 293
Als Kind hatte Saint-Exupéry offenbar eine fast religiöse Ehrfurcht vor dem Schriftstellerberuf, die er auch nie verlor. Für Kinder und schlichte (...)
Caillois, Roger
Gespräch mit Roger Caillois (1978), S. 300
Noll, Chaim
Die Metapher Wüste. Literatur als Annäherung an eine Landschaft, S. 309
Die Wüste gehört zu den großen Siegern unserer Tage. Und es scheint, als wäre dieser Sieg für den Menschen nichts anderes als eine Katastrophe. (...)
Manea, Norman
Fünfzig Jahre Nouvelle Revue Française in Bukarest. Die Cioran-Noica-Debatte, S. 326
Enzensberger, Hans Magnus
Gespräch mit Thomas Wild. »Ich habe vor allem Hannah Arendts Haltung bewundert, ihre Unabhängigkeit«, S. 331
Arendt, Hannah
Hannah Arendt und Hilde Domin. Briefwechsel 1960-1963, S. 340
Pavlovic, Miodrag
Gedichte, S. 356
Täubert, Klaus
Zwillingsbrüder. Herbert Schlüter und Klaus Mann, S. 359
Die Briefpartner lernten sich im März 1926 kennen: Klaus Mann war der Einladung zu einer Matinee seines Theaterstücks »Anja und Esther« im (...)
Mann, Klaus
Herbert Schlüter, Klaus Mann. Briefwechsel 1933-1949, S. 370
Schlüter, Herbert
Aus dem Italienischen Tagebuch, S. 404
Hartung, Harald
Poesie und Kritik. Denkbarkeiten, Dankbarkeiten. Rede zum Johann-Heinrich-Merck-Preis, S. 419
Grünbein, Durs
Dieser besondere Kreis. Dankrede zur Aufnahme in den Orden Pour le mérite, S. 422