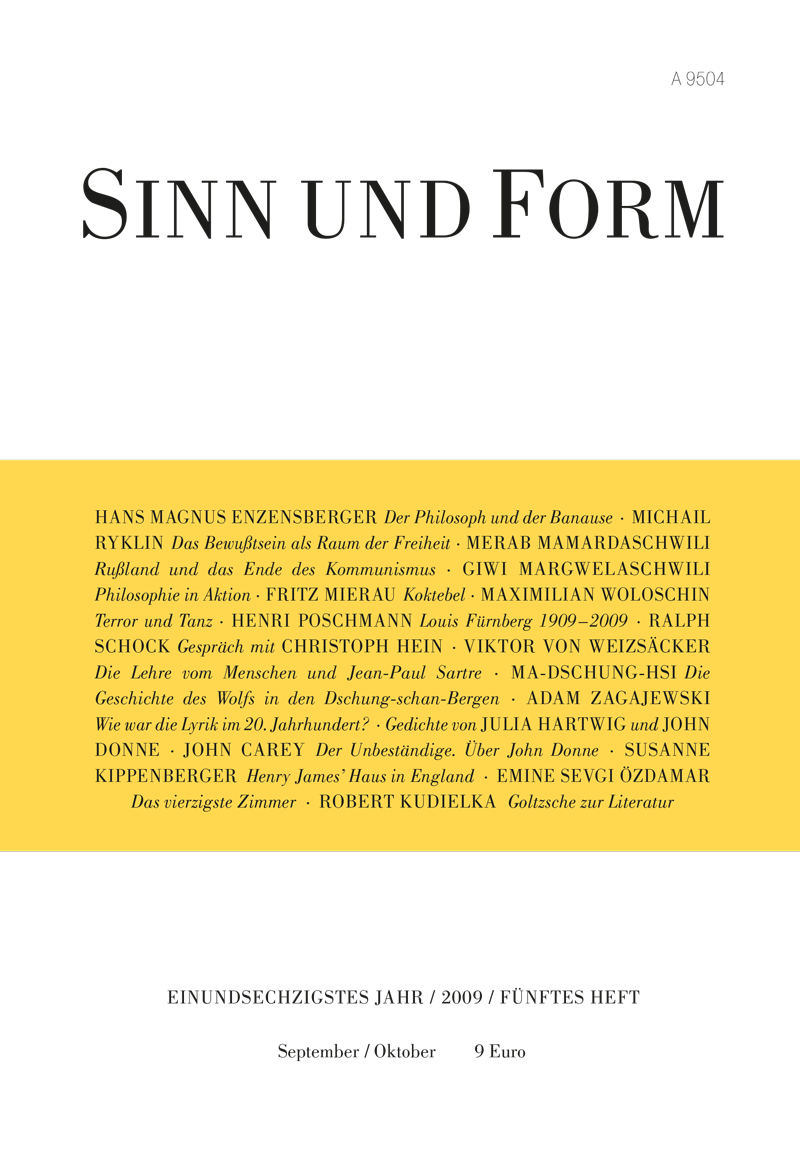Heft 5/2009 enthält:
Enzensberger, Hans Magnus
Der Philosoph und der Banause, S. 581
Ryklin, Michail
Das Bewußtsein als Raum der Freiheit. Merab Mamardaschwili als philosophischer Lehrer, S. 585
Mamardaschwili, Merab
Der dritte Zustand. Rußland und das Ende des Kommunismus, S. 591
Margwelaschwili, Giwi
Philosophie in Aktion. Über Merab Mamardaschwili, S. 598
Mierau, Fritz
Koktebel - Blaues Siegel oder Erfindung einer Landschaft, S. 603
Vor vierzig Jahren überwältigte mich der Anblick einer Küstenlandschaft am Schwarzen Meer. Auf meiner russischen Reise vom Sommer 1965 hatte ich (...)
Woloschin, Maximilian
Terror und Tanz, S. 614
Poschmann, Henri
Durch Hölle, Haß und Liebe. Louis Fürnberg 1909 - 2009, S. 620
Hein, Christoph
Gespräch mit Ralph Schock, S. 628
RAPLH SCHOCK: Vor mehr als 25 Jahren erschien Ihre Novelle »Der fremde Freund«. Sie fand große Resonanz. Wie denken Sie heute über diesen (...)
Weizsäcker, Viktor von
Die Lehre vom Menschen und Jean-Paul Sartre. Mit einer Vorbemerkung von Rainer-M. E. Jacobi, S. 640
Dschung-Hsi, Ma
Die Geschichte des Wolfs in den Dschung-schan-Bergen, S. 654
Zagajewski, Adam
Märtyrer und Komödianten oder Wie war die Lyrik im 20. Jahrhundert?, S. 662
Hartwig, Julia
Gedichte, S. 667
Donne, John
Elegien. Nachdichtungen von Michael Mertes, S. 672
Carey, John
Der Unbeständige. Über John Donne, S. 690
John Donne war ein Dichter neuen Typs. Seine Originalität beeindruckte die Zeitgenossen. Sie meinten, daß er das literarische Universum verändert (...)
Kippenberger, Susanne
Henry James' Haus in England, S. 705
Özdamar, Emine Sevgi
Das vierzigste Zimmer. Rede zum Fontane-Preis, S. 711
Kudielka, Robert
Abschweifungen. Goltzsche zur Literatur, S. 713